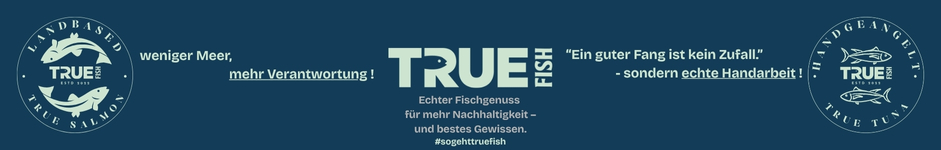04.10.2010
Chile will Lachsproduktion 2011 um 20 Prozent steigern
Chiles Lachszüchter lassen die schwere, durch die Infektiöse Salmanämie (ISA) verursachte Krise zunehmend hinter sich: im kommenden Jahr soll die Produktion um 20 Prozent steigen, schreibt das Portal IntraFish. Allerdings zeigen allein die Zahlen des größten Züchters – AquaChile –, dass der Weg zum status quo ante noch lang ist: in diesem Jahr will der Ranglistenerste geschätzte 50.000 t ernten, im kommenden Jahr 60.000 t. Zum Vergleich: 2006 produzierte AquaChile 100.000 t Lachs. Doch die Branche ist optimistisch, teilte Cesar Barros, Präsident von SalmonChile, mit. Viele Industrielle rechnen damit, dass sich der Sektor in etwa fünf Jahren erholt haben wird. Die Lachsseuche ISA war 2007 ausgebrochen.01.10.2010
Russland: Russian Sea startet mit Surimi
Das größte Seafood-Unternehmen in Russland, die Russian Sea Group, will beginnen, den interessanten Binnenmarkt für Surimi zu beliefern, schreibt das Portal IntraFish. Russian Sea ist unter eigener Brand Marktführer für Hering, Lachs, Forelle, roten Kaviar und Fischaufstriche, außerdem Rangvierter bei Seafood-Präserven. Surimi wurde bislang nicht angeboten. Zunächst wolle man in Lettlands Hauptstadt Riga Surimi im Auftrag produzieren lassen, teilte Geschäftsführer Dmitry Dangauer mit, später soll eventuell eine eigene Fabrik gebaut werden. Die Russian Sea Group ist an der Moskauer Börse gelistet. Analysten schätzten, dass der Produzent 15 bis 19 Mio. Euro aus seinem Börsengang im April dieses Jahres für die Surimi-Produktion verwenden werde.01.10.2010
London: Lastenträger des Fischmarkts Billingsgate sollen Monopol verlieren
Auf dem Londoner Fischmarkt Billingsgate, dem größten Englands, soll die privilegierte Berufsgruppe der Lastenträger historische Rechte verlieren, schreibt die FAZ. Die sogenannten „Porter“ karren für Großkunden die Fischkisten von den Ständen der Fischhändler in der Markthalle zu den Lieferwagen auf dem Parkplatz. Nach den Marktstatuten von 1876 dürfen die Fischhändler selbst keine Kisten transportieren. Die Porter wiederum brauchen eine Lizenz der Stadtverwaltung. Für diese Hilfstätigkeit erhalten die Fisch-Porter mindestens 22.000 Pfund (rund 27.000 Euro) im Jahr - für einen Halbtagsjob von 20 Stunden in der Woche. Fischhändler Chris Holmes muss seinen Portern sogar zwischen 34.000 und 39.000 Pfund - das sind 39.400 und 45.200 Euro - im Jahr zahlen: „Die Löhne, die ich zahlen muss, sind lächerlich hoch.“30.09.2010
Pangasius: Fish & Chips-Shop verkauft Pangasius als Kabeljau
Der Inhaber eines englischen Imbisses ist von einem Bezirksgericht verurteilt worden, weil er seinen Kunden wissentlich Pangasius als Kabeljau verkauft habe, schreibt IntraFish unter Berufung auf die Worcester News. Für Mustafa Kilicaslan, Inhaber von „Marco’s Pizza“ (Evesham/Worcestershire), war es ein interessantes Geschäft: während Pangasius-Filets etwa 5,90 Euro/Kilo kosteten, musste er für Filets vom Kabeljau 14,20 Euro/Kilo zahlen. Auf der Speisekarte erfuhr der Kunde nicht, dass sein Fish & Chips-Gericht vietnamesischen Wels (Pangasius hypophthalmus) enthielt.29.09.2010
Bundesweite MSC-Kampagne: „Teller frei! Für nachhaltigen Fisch“
„Teller frei! Für nachhaltigen Fisch“ lautet der Titel einer Kampagne des Marine Stewardship Councils (MSC), die am morgigen Donnerstag, den 30. September 2010, bundesweit stattfindet. Gemeinsam mit 43 Partnern des Foodservice-Sektors ruft der MSC mit dieser Aktion Verbraucher auf, bewusst Fisch aus nachhaltigem Fang zu konsumieren und klärt über sein blaues Siegel für nachhaltigen Fischfang auf. Teilnehmer sind sechs Studentenwerke - Köln, Frankfurt, Karlsruhe, Freiburg, Göttingen und Stuttgart - mit jeweils mehreren Standorten wie auch die Kantinen im Bundespräsidialamt, im Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (BMELV) und im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ). Mit dabei sind auch die Fischfachhändler Fisch Anton (mit sieben Standorten), Seybolds Fischhalle (zwei), Arentz Fisch (drei) und Fiedlers Fischmarkt anno 1906.29.09.2010
Großbritannien: Morpol kauft britische Lachsräucherei Brookside
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
29.09.2010
Edeka plant Übernahme von Ratio-Handelsgruppe
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
28.09.2010
Piraterie: Thunfisch-Fänger erhalten „Panik-Räume“
Die Reeder spanischer Thunfisch-Fangschiffe, die in den Gewässern vor Somalia fischen, wollen auf ihren Schiffen hermetisch abgeriegelte Räume schaffen, in die sich die Mannschaft bei Piratenangriffen zurückziehen kann, schreibt IntraFish. Spaniens Verteidigungsministerium unterstützt dieses Selbstverteidigungsprojekt. Die „Panik-Räume“ stehen in Funkverbindung mit den multinationalen Marinetruppen der Operation Atalanta, die die Schifffahrt am Horn von Afrika schützen soll. Im Indischen Ozean operieren derzeit 30 Thunfisch-Seiner, von denen 13 die spanische Flagge tragen. Die Flotte des Landes hat bislang eine Million Euro in Sicherheitsmaßnahmen investiert, die jeweils hälftig von den Schiffseignern und der Regierung getragen wurden.27.09.2010
Neuseeland erhöht Fangquote für Hoki auf 120.000 Tonnen
Neuseelands Fischereiministerium hat die Fangquote für den Hoki (Macruronus novaezealandiae) zum 1. Oktober um 10.000 t auf 120.000 t angehoben, meldet das Portal IntraFish. Die TAC für den Granatbarsch oder Orange roughy auf dem Chatham Rise ist hingegen von bislang 8.350 t um 3.510 t auf nur noch 4.840 t gekürzt worden. Weitere 500 t Granatbarsch dürfen auf dem Challenger Plateau gefischt werden, das seit seiner Schließung im Oktober 2000 erstmals wieder für die Fischerei geöffnet ist. Neuseeland besitzt zwei Hoki-Bestände, den westlichen und den östlichen. Der westliche hat sich in den vergangenen Jahren nach einer Zeit geringen Nachwuchses wieder erholt. Der östliche Hoki-Bestand war durchgehend biologisch gesund und ist zu keinem Zeitpunkt unter die Sollgröße gefallen. Ein Sprecher des Fischereiministeriums, Wayne McNee, teilte mit, wissenschaftliche Modelle zeigten, dass der Hoki-Bestand selbst nach der Quotenanhebung weiter wachsen werde. Der Fisch ist Neuseelands drittwichtigster Exportartikel im Bereich Seafood - nach Muscheln und Langusten - und erwirtschaftete 2009 gut 83,9 Mio. Euro. Der Granatbarsch liege auf Rang 6 mit einem Exporterlös von 28,1 Mio. Euro.24.09.2010
Nordseegarnelen: Fischer erstreiten Preisanstieg auf 2,75 Euro
Aufgebrachte Fischer haben am vergangenen Mittwoch den Hauptsitz der Heiploeg-Gruppe im niederländischen Zoutkamp (Groningen) blockiert. Der Grund: die beiden marktbeherrschenden Großhändler für Nordseekrabben, Heiploeg und Klaas Puul, hatten Anfang September die Kilopreise von zuvor 3,25 Euro für größere Garnelen und 2,75 Euro für die kleinere Ware gesenkt. Seitdem wurden nur noch 2,25 Euro/Kilo gezahlt, sagte Dirk Sander, Vorsitzender der Erzeugergemeinschaft der Küstenfischer Weser-Ems. Das war den Fischern zuwenig. Deshalb hatten Krabbenfischer von Südholland bis Dänemark ab Montag die Ausfahrt verweigert bzw. ihre Fangaktivitäten erheblich eingeschränkt. Rund 480 Kutter – davon 250 in Deutschland – sollen am Dienstag im Hafen geblieben sein.- Nordseekrabben
- Crangon crangon
- Thünen-Institut
- Lara Kim ...
- Bremerhaven
- Institut fü...
- Mowi
- Mowi Scotland
- Schottland
- Lachszucht
- Lachslaus
- Seehase
- Putzerfisch
- Lippfisch
- Amazon
- USA
- Lieferdienst
- Frischedienst
- Schottland
- Schottischer Lachs
- Lachszucht
- Salmon Scotland
- Tavish Scott
- Wechsler Feinfisch
- Insolvenz
- Erftstadt
- Theo Jansen