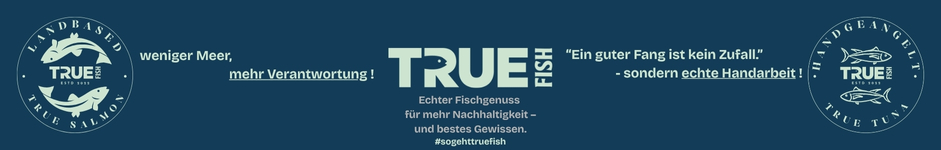30.01.2014
Färöer Inseln: Neue Verarbeitung für Schwarmfische
Auf den Färöer Inseln soll in diesem Sommer ein neuer Verarbeitungsbetrieb für pelagische Fischarten den Betrieb aufnehmen, meldet das Portal IntraFish. Investoren und Eigner sind Havsbrun, eine 100%ige Bakkafrost-Tochter, sowie die Schwarmfischfangunternehmen Sp/F Framherji und P/F Palli hja Mariannu, die insgesamt 26,8 Mio. Euro in den Fabrikneubau investieren. Davon sollen 2,1 bis 2,7 Mio. Euro von Havsbrun stammen, die im Gegenzug zu 30 Prozent beteiligt sind. Die Produktion soll nicht nur ganze Fische frosten, sondern auch Filets und Fische ohne Kopf schneiden, heißt es in einer Erklärung der an der Osloer Börse gelisteten Bakkafrost. Die tägliche Gefrierkapazität werde bei 600 Tonnen liegen. Der Lachszüchter Bakkafrost wolle die Fabrik jedoch nicht selber betreiben, sondern sehe die Beteiligung als strategische Investition, erklärte Geschäftsführer Regin Jacobsen: "Wir wollen uns den langfristigen Zugriff auf marine Rohstoffe für die Produktion unseres Lachsfuttes sichern." Abschnitte und aussortierte Fische aus der Schwarmfisch-Verarbeitung machten einen Großteil der eingesetzte Rohware aus. Der Schwarmfischbetrieb steht entsprechend direkt neben der Fischmehl- und Fischfutter-Fabrik von Bakkafrost in Fuglafjørdur.30.01.2014
Frankreich: Logistiker STEF investiert über 8 Mio. Euro in Boulogne
Das französische Transport- und Logistikunternehmen STEF will in den kommenden zwei Jahren zwischen 8 und 10 Mio. Euro in die Erweiterung und Renovierung seiner Plattform in Boulogne-sur-Mer investieren, meldet das Portal IntraFish. Bis Ende 2015 soll die bestehende Fläche von 6.000 Quadratmetern mit 56 Andockstationen um 5.600 Quadratmeter erweitert und die bestehende Einrichtung komplett renoviert werden. STEF Transport ist aufgrund seiner strategischen Lage zwischen Nord- und Südeuropa ein wichtiger Hub für Seafood-Importe aus Großbritannien und Skandinavien, aber auch für Mittelmeerfisch wie Wolfsbarsch und Dorade für Deutschland, England, Belgien und die Niederlande.30.01.2014
Bremerhaven: Spatenstich für 2. Bauabschnitt Forum Fischbahnhof
Im Bremerhavener Fischereihafen wurde am vergangenen Freitag mit einem symbolischen Spatenstich der zweite Bauabschnitt für das modernisierte Forum Fischbahnhof eingeläutet. Alleine in die zweite Bauphase fließen rund 3,6 Mio. Euro aus Landes- und EU-Mitteln. Im Rahmen der Modernisierung werden die Ausstellungs- und Veranstaltungsbereiche neu konzipiert. Im Rahmen einer einzigartigen Ausstellung rund um das Thema Fisch werden zahlreiche Exponate aus der Landessammlung des Nordseemuseums präsentiert, darunter auch ein imposantes Walskelett. Gleichzeitig wird der Hallencharakter des ehemaligen Fischversand-Bahnhofs wieder zum Vorschein gebracht. "Durch die entschlossene und gelungene Umgestaltung des Forums Fischbahnhof wird das Schaufenster Fischereihafen noch attraktiver und wir haben die Chance, die Besucherzahlen weiter zu steigern", sagte FBG-Geschäftsführerin Petra Neykov. Der Fischereihafen und das Schaufenster zählten jährlich mehr als 800.000 Besucher. Das Seefischkochstudio, dessen Umbau bereits im Oktober 2012 begonnen hatte, soll bereits im Mai neu eröffnet werden.30.01.2014
Biologie: Geringere Fischlänge aufgrund steigender Meerestemperaturen
Zwischen der Durchschnittslänge von Fischen und steigenden Wassertemperaturen in der Nordsee könnte ein Zusammenhang bestehen. Das zumindest vermuten Forscher der schottischen Universität Aberdeen nach der Untersuchung verschiedener Arten, schreibt Fish Information & Services (FIS). Die Wissenschaftler hatten in ihrer Studie festgestellt, dass sich bei Schellfisch, Wittling, Hering, Stintdorsch, Scholle und Seezunge in der Nordsee die Länge innerhalb der vergangenen 38 Jahre um durchschnittlich 29 Prozent verringert habe. Die Analyse der über vier Jahrzehnte gesammelten Daten identifizierte als einen Faktor, der bei allen diesen Fischen gemeinsam sei, den Anstieg der Wassertemperatur um ein bis zwei Grad.29.01.2014
FIAP: Anbieter von Aquakultur-Produkten mit komplett neuer Website
Die FIAP, nach eigenen Angaben weltweit führender Premiumanbieter von Aquakulturprodukten, präsentiert sich mit einer neuen Internetseite. "In einer umfangreichen Verjüngungskur hat die Homepage www.FIAP.com nicht nur ein schickes Design, sondern auch einen komplett neuen Inhalt erhalten", erklärt Geschäftsführer Tobias Rösl. Das neue Design und ansprechende Bilder sollen den Aquakultur- und Gartenteich-Interessenten sofort in ihren Bann ziehen. Die komplett neue Seitenstruktur orientiere sich an den Interessen und am Nutzungsverhalten der Kunden: kurze Texte, passende Bilder von Produkten und aus der Praxis, außerdem Grafiken und Produktvideos. Rösl: "Besonderes Augenmerk wurde auf eine möglichst umfangreiche und informative Präsentation des FIAP-Produktsortiments gelegt." Die Integration sozialer Netzwerke und Plattformen wie Facebook, Twitter und YouTube "lasse die Website authentisch wirken". Über ein Shopsystem im Bereich Aquakultur und die Verlinkung zu einem Online-Partner im Bereich Gartenteich können die Besucher bequem online einkaufen.29.01.2014
Holland: Morubel wird selbständig
Die ehemalige Heiploeg-Tochter Morubel, Produzent von TK-Garnelen, ist im Gegensatz zum niederländischen Mutterunternehmen nicht von Parlevliet & Van der Plas (P&P) gekauft worden. "Allmählich ist klar geworden, dass TK und Frische zwei ziemlich verschiedene Segmente mit jeweils eigener Dynamik sind, die auch unterschiedliche Herangehensweisen erfordern", heißt es in einer Pressemitteilung des im belgischen Oostende ansässigen Herstellers. Morubel (Jahresumsatz: 80 Mio. Euro) gehört bislang noch der Rabobank, die jedoch verkaufen will. Verkaufsleiterin Nadine Verbruggen betont allerdings: "Wir suchen nicht aktiv nach einem neuen Investor, aber es gibt viele Möglichkeiten." Zum einen sei es wichtig, dass es "weiter geht wie bisher", andererseits wolle Morubel sein Produktsortiment für die diesjährige Seafood Expo Global in Brüssel neu ausrichten und dort neue Produkte präsentieren. Auf der Messe, der ehemaligen European Seafood Exposition (ESE), wird Morubel erstmals als unabhängiges Unternehmen ausstellen. Obgleich bislang überwiegend Private Label-Kunden bedient wurden, sowohl im LEH als auch im GV-Segment, soll in Zukunft ein Fokus auf die Marke Morubel gelegt werden. Das 1954 gegründete Unternehmen war seit 1999 Teil der Heiploeg-Gruppe. Jährlich können 14.000 t verarbeitet werden, insbesondere tropische Shrimps und weiteres Seafood.29.01.2014
Chile: Fischereien auf Langostinos und Garnelen starten MSC-Zertifizierung
Die chilenischen Fischereien auf Langostinos (Cervimunida johni und Pleuroncodes spp.) und Garnelen (Heterocarpus spp.) haben eine Bewertung nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) für Nachhaltigkeit und gutes Management beantragt. Klienten des MSC sind zwei Verbände: die Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de la IV Región (AIP) und die Asociación de Exportadores de Frutas de Chile A.G. (ASOEX). Die in Chile kollektiv als Krebstierfischerei bezeichnete Fischerei wird vor der Küste zwischen 26º und 38º südlicher Breite betrieben. Teil der Bewertung, die in den Händen des unabhängigen Zertifizierers Intertek Fisheries Certification (IFC) liegt, sind acht Einheiten. Die Fangsaison für die Garnelen ist ganzjährig mit einer Schließung im Juli und August, während beide Langostino-Arten von April bis Dezember befischt werden. Im Jahre 2011 waren insgesamt 27 Fangboote operativ, davon 20 industrielle, die übrigen sieben kleinere Küstenfischer. Während bei den erstgenannten die Inhaber Fangmengen erhalten, teilen sich letztere eine gemeinsame Quote. 2013 wurden insgesamt 3.166 t Garnelen und 7.261 t Langostinos angelandet, davon 2.493 t Cervimunida johni und 4.754 t Pleuroncodes spp. Vermarktet werden die Krebstiere vor allem in Nordamerika und Europa.28.01.2014
Holland: Parlevliet kauft Heiploeg aus der Insolvenz
Der holländische Garnelenlieferant Heiploeg ist heute von der ebenfalls holländischen Parlevliet & Van der Plas-Gruppe (P&P) gekauft worden, nachdem das Unternehmen am Morgen von einem niederländischen Gericht für bankrott erklärt worden war, schreibt das Portal IntraFish. Die Heiploeg-Insolvenz kommt nicht ganz unerwartet, denn die seit mehreren Jahren verschuldeten Niederländer kämpften zuletzt mit einer Schuldenlast von 130 Mio. Euro. Dazu hatte auch eine Geldbuße in Höhe von 27 Mio. Euro beigetragen, die die EU-Kommission Ende 2013 gegen Heiploeg verhängt hatte. Die neue Firma soll unter dem Namen Heiploeg International B.V. mit einer schlankeren Organisation Teil der P&P-Gruppe werden. Heiploeg-Direktor Edo Abels bedauerte die Insolvenz, konnte jedoch als gute Nachricht vermelden, dass die meisten Beschäftigten ihre Arbeitsplätze behalten werden. Das gelte etwa für 300 Mitarbeiter am Produktionsstandort Zoutkamp. Auch die Belieferung der Kunden mit Garnelen sei weiterhin gewährleistet. Das Familienunternehmen Parlevliet & Van der Plas mit Hauptsitz im niederländischen Valkenburg sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Spanien und Litauen beschäftigt 1.500 Menschen und hat Fangschiffe weltweit im Einsatz. Kernaktivitäten sind der Fang, die Verarbeitung und der Handel von Hering, Makrele und Kabeljau.28.01.2014
Hamburg: Damanaki startet Kampagne zur Nachhaltigkeit
Die EU-Kommissarin für Fischerei Maria Damanaki hat gestern in Hamburg die neue Kampagne der Europäischen Union für eine nachhaltige Fischereipolitik vorgestellt. Unter dem Titel "Inseparable: Eat, Buy and Sell sustainable Fish" - deutsch: "Unzertrennlich - nachhaltigen Fisch essen, kaufen und verkaufen" - sollen alle EU-Bürger darüber informiert werden, wie sie mit einer Änderung der Ess-, Kauf- und Verkaufsgewohnheiten verantwortungsbewusst und nachhaltig Fische und Meereserzeugnisse konsumieren können. Die Kampagne begleitet die Reform der gemeinsamen EU-Fischereipolitik, die das Thema Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellt und seit Anfang Januar in Kraft ist. So sollen ab 2015 die Rückwürfe von Beifängen stufenweise abgebaut werden, bis sie von 2019 an vollständig verboten sein werden. Den Verbraucher fordern die EU-Bürokraten auf: "Pochen Sie bei jedem Fischerzeugnis auf Nachhaltigkeit - Ihre Nachfrage bestimmt das Angebot!" Zur praktischen Umsetzung empfiehlt die EU-Internetseite zur Kampagne: "Fragen Sie Ihre lokalen Fischer oder Ihren Fischverarbeitungsbetrieb, woher ihre Ware stammt und ob sie sich den Prinzipien der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlen."28.01.2014