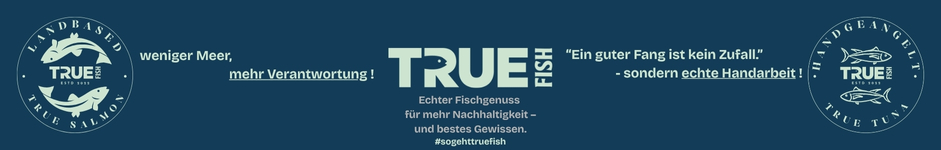17.02.2014
DLG-Qualitätsprüfung Fisch & Seafood: Anmeldung bis 17. April 2014
Das Testzentrum Lebensmittel der DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) hat seine Internationale Qualitätsprüfung für Fisch & Seafood ausgeschrieben. Der wissenschaftliche Expertentest besteht aus sensorischen Produkttests, die um Deklarationskontrollen sowie Laboranalysen (z.B. Mikrobiologie) ergänzt werden. Produkte, die die DLG-Tests bestehen, werden mit den Goldenen, Silbernen oder Bronzenen DLG-Preisen ausgezeichnet. Anmeldeschluss ist der 17. April 2014. Das Prüfspektrum umfasst küchen- und garfähige sowie verzehrfertige Produkte. Getestet werden Menükomponenten, Komplettmenüs, Snacks und Feinkosterzeugnisse in den Angebotsformen Tiefkühlkost, Kühlware, Nasskonserve oder Trockenprodukte. DLG prämierte Produkte, deren Rohstoff aus einer bestandserhaltenden Fischerei stammt, werden mit entsprechendem Hinweis in der DLG-Preisträgerdatenbank veröffentlicht. Damit erhalten Verbraucher wichtige Zusatzinformationen über das ausgezeichnete Produkt.14.02.2014
Färöer: Lachsseuche ISA erstmals seit neun Jahren
Erstmals seit neun Jahren ist in einer Lachszucht auf den Färöer Inseln wieder der Viruserreger der Infektiösen Salmanämie (ISA) nachgewiesen worden, meldet das Portal IntraFish. Die Färingische Behörde für Lebensmittelsicherheit (HFS) bestätigte, dass der ISA-Erreger in einer Farm von Bakkafrost entdeckt worden sei, und zwar eine gefährliche Variante von HPR. Nur wenige hundert Meter nördlich der betroffenen Farm liegt die Zucht Vedran, die zu Marine Harvest Faroes gehört. Um eine Ausbreitung zu verhindern, werden zwei Bakkafrost-Zuchten und die genannte Farm von Marine Harvest abgeerntet. Außerdem werde die gesamte Region von Ei∂i im Norden bis Tórshavn im Süden auf einer Länge von gut 50 Kilometern einer strengeren Kontrolle unterzogen. Schon im Verdachtsstadium hatte die ISA-Meldung noch am ersten Tag zu einem Kursverlust der Bakkafrost-Aktie an der Osloer Börse um fast 6 Prozent geführt. Auf den Färöern sei man jedoch zuversichtlich, die Seuche in den Griff zu bekommen. Denn während bei einem ersten ISA-Ausbruch im Jahre 2001 die Existenz Dutzender kleinerer Unternehmen eine koordinierte Bekämpfung erschwert hatte, gibt es auf den Inseln heute nur noch vier Produzenten - neben Bakkafrost und Marine Harvest sind das Hiddenfjord und Faroe Farming.14.02.2014
Polen: Wilbo nach zwei Insolvenzverfahren wieder im Geschäft
Nach drei schweren Jahren konnte der polnische Fischproduzent Wilbo jetzt langjährige Lieferkontrakte in fast zweistelliger Millionenhöhe abschließen, meldet das Portal IntraFish. Anfang des Jahres unterzeichnete der in der Hafenstadt Gdynia, ehemals Gdingen, ansässige, an der Warschauer Börse gelistete Hersteller insbesondere von Konserven und TK-Fisch einen Abschluss mit Kazakhstan Orca Global über 500.000 Euro, mit Russian Capitan (Kaliningrad) über 2,5 Mio. Euro und mit Captain Nemo über 5 Mio. Euro. "Die Betriebsstrategie des Unternehmens basiert auf der Ausweitung des bestehenden Sortiments und einem Ausbau der Exportfähigkeit", erklärte die polnische Marktanalystin Honorata Jarocka. Die Wilbo-Marken Neptun, Taaka Ryba und Dal Pesca sollen einen Relaunch erfahren. Unter Dal Pesca beispielsweise werden jetzt auch panierte TK-Weißfischprodukte und gefrorene Natur-Weißfischportionen gehandelt. Wilbo hatte unter dem Druck steigender Produktions- und Rohwarenkosten erstmals im Juli 2012 Insolvenz anmelden müssen und ein zweites Mal im Januar 2013. Noch immer sucht der Hersteller frisches Kapital. In einem überfüllten polnischen Markt steht Wilbo im Wettbewerb mit Produzenten wie Graal und Lisner, aber auch mit Handelsmarken.14.02.2014
USA/Italien: Mafia wollte flüssiges Kokain in gefrorenem Fisch schmuggeln
Kokain und Heroin im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar wollten amerikanische und italienische Mafia-Familien von Südamerika nach Italien und in die USA schmuggeln - unter anderem in Tiefkühlfisch, schreibt die Schweizer Pendlerzeitung "20 Minuten". Am Dienstag verhafteten rund einhundert FBI-Beamte und italienische Polizisten 26 mutmaßliche Drogenhändler - 8 in New York, 18 in Italien - und zerschlugen damit einen neuen internationalen Kokain- und Heroinhändler-Ring. Geplant war, das Kokain in flüssiger Form zusammen mit gefrorenen Ananas und Fisch versteckt aus dem südamerikanischen Guyana nach Italien zu verschiffen. Im italienischen Hafen von Gioia Tauro (Kalabrien) war bereits ein bestechlicher Zollbeamter gefunden worden, einen Fischgroßhändler hatte die Mafia übernommen. Von Italien aus sollte wiederum Heroin in die USA verschifft werden. Laut FBI wollten die Verhafteten die so genannte "Pizza Connection" wieder aufleben lassen, einen Drogenring aus US-amerikanischen Mobsters und der sizilianischen Cosa Nostra in den 1970er- und 1980er Jahren. Diesmal war aber die kalabrische 'Ndrangheta beteiligt, die heute den Drogenhandel kontrolliert.13.02.2014
Lüneburg: Sozialplan für 54 Pickenpack-Mitarbeiter
Bei Pickenpack haben sich Geschäftsleitung und Arbeitnehmervertreter am vergangenen Montag auf einen Sozialplan und Interessenausgleich verständigt, meldet die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Demnach werde der TK-Fischhersteller bis zu 54 betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Die betroffenen Mitarbeiter erhalten eine Abfindung in Höhe von 75 Prozent ihres tariflichen Monatsverdienstes und zusätzliche Einmalzahlungen für unterhaltsberechtigte Kinder oder bei Schwerbehinderung. Das Ergebnis war nach einem zehnstündigen Verhandlungsmarathon in der Einigungsstelle unter Vorsitz des Direktors des Braunschweiger Arbeitsgerichts Dr. Rainer Pieper zustande gekommen. NGG-Sprecherin Silke Kettner zeigte sich leidlich zufrieden mit Verweis darauf, dass Pickenpack zunächst nur 30 Prozent eines Monatsverdienstes als Abfindung geboten hatte. Allerdings kritisierten Betriebsrat und Gewerkschaft, dass es nicht zur Einrichtung einer Beschäftigungs- und Transfergesellschaft kommen werde. Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit sollten für die überwiegend un- oder angelernten Kräfte jetzt Qualifizierungsmaßnahmen organisiert werden.13.02.2014
Augsburg: Fischgeschäft Schöppler hat zum 1. Februar geschlossen
In Augsburg ist zum 1. Februar eine 84-jährige, ja sogar mehr als 360 Jahre alte Tradition zu Ende gegangen: am Stadtmarkt der bayerischen Metropole hat das Geschäft "Stadtfischer Schöppler" dicht gemacht. Seit Eröffnung des Stadtmarktes im Jahre 1930 war die Familie mit dabei, zuletzt führten die Schwestern Barbara Liebert und Mechthild Dobler das Fischgeschäft in vierter Generation. Bis vor einigen Jahren hatte die Familie Schöppler auch ein Fischfachgeschäft in der Karolinenstraße 11. Der Laden am Stadtmarkt sei seit 1972 nicht mehr modernisiert worden, teilt der Augsburger Regionalsender a.tv mit. Einen Nachfolger habe man nicht gefunden, nannte Barbara Liebert einen Grund für die Geschäftsaufgabe. Auch Marktamtsleiter Werner Kaufmann nennt in der Augsburger Allgemeinen als ein Problem "die Investitionskosten und die Unsicherheit wegen der notwendigen Renovierung der Fischstände als letzten Bauabschnitt der Stadtmarktsanierung." In den Annalen der Stadt Augsburg ist der Stadtfischer Schöppler schon im Jahre 1650 nachgewiesen.13.02.2014
Holland: P&P setzt verstärkt auf seegefrostete Filets
Der holländische Fischfang- und Fischverarbeitungskonzern Parlevliet & Van der Plas (P&P) lässt in der Türkei für 35 Mio. Euro zwei neue Weißfisch-Fangschiffe bauen. Das erfuhr IntraFish-Redakteurin Elisabeth Fischer auf der Bremer Fish International von Oskar Sigmundsson, Geschäftsführer der P&P-Tochter German Seafrozen Fish. Die beiden Schiffe mit einer Kapazität von jeweils 1.000 t und einer Länge von 86,10 Metern sollen zwei der derzeit rund 30 P&P-Schiffe ersetzen. Die Neubauten seien ein Bekenntnis zur seegestützten (FaS) Verarbeitung, sagt Sigmundsson. Die Nachfrage nach einmal gefrorenem Weißfisch sei ein qualitätsbedingter Trend: "Viele Kunden wurden durch 'billigen' Weißfisch wie Pangasius enttäuscht." Die Investitionen ermöglichen P&P die Erweiterung der Produktion in Europa. Das reduziere Planungsrisiken, verkürze die Lieferfristen und steigere die Effizienz, erklärt der Geschäftsführer. Außerdem können die Portionskontrolle und die Produktkalibrierung verbessert werden. Schließlich sei die Verarbeitung in China auch nicht mehr so billig wie sie einmal war. In Deutschland und generell in Zentraleuropa registriert German Seafrozen eine steigende Nachfrage nach FaS-Weißfisch, vor allem nach Kabeljau. Allerdings stiegen die Kabeljaupreise: seegefrorene Filets kosteten inzwischen rund 5,- Euro/kg.12.02.2014
Fischmesse Bremen mit vollen Gängen und zufriedenen Ausstellern
Nach drei Tagen hat gestern die 14. Fish International auf dem Bremer Messegelände ihre Tore geschlossen. Volle Gänge am Messesonntag und zahlreiche Entscheidungsträger aus dem Lebensmittelhandel sowie dem GV-Sektor am Montag und Dienstag lassen die Aussteller ein deutlich positives Fazit der Veranstaltung ziehen. Für einige war es „die beste Fischmesse seit langen Jahren.“ 230 Firmen aus 20 Ländern präsentierten sich in den Hallen 4 und 5 der Bremer Messe und zogen 11.000 Fischfachleute aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland in die Hansestadt. Mittelpunkt der Messe war der Stand von Transgourmet Seafood aus Bremerhaven. Der Großhandel war mit zahlreichen Kooperationspartnern auf die Branchenschau gekommen und stellte eine Fülle von neuen Produkten und Konzepten vor. Gesprächsthema war außerdem die Deutschlandpremiere von ASC-zertifiziertem Lachs. Die Fischmesse bot wieder einmal eine attraktive Mischung aus Produktschau, Diskussion aktueller Themen und der Möglichkeit zum Aufbau und zur Pflege von Kontakten.10.02.2014
Branchenpreis Seafood Star in Bremen verliehen
Das FischMagazin hat auf der Bremer Fischmesse zum siebten Mal den Branchenpreis Seafood Star an herausragende Konzepte aus dem Fischhandel verliehen. In diesem Jahr ging die Auszeichnung an Preisträger in elf Kategorien:07.02.2014