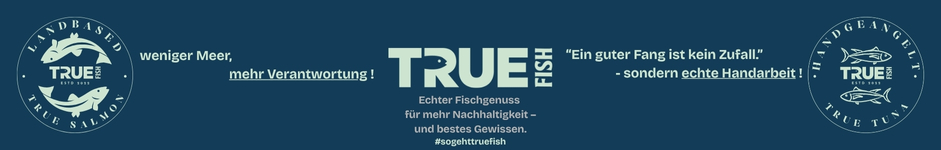08.10.2014
Alaska: Fangquote für Bristol Bay-Königskrabben um 16 Prozent erhöht
In der US-amerikanischen Bristol Bay (Alaska) dürfen in der am 15. Oktober beginnenden Fangsaison 2014/15 insgesamt 9,9 Mio. Pounds (4.494 t) Königskrabben gefangen werden - ein Plus von 16,1 Prozent gegenüber den 8,6 Mio. Pounds (3.904,4 t) in der letztjährigen Saison. Das teilten Alaskas Behörde für Fisch & Wild (ADF&G) und die Nationale US-Fischereibehörde (NMFS) am Montag mit, schreibt IntraFish. Damit ist die Fangquote für die 'red king crab' im östlichsten Arm des Beringmeers im zweiten Jahr in Folge zweistellig angehoben worden, nachdem sie schon 2013 um 18 Prozent höher gelegen hatte als 2012.08.10.2014
Kanada: 24 Mio. Euro für Wildlachs-Besatzmaßnahmen
Die kanadische Regierung hat für die kommenden fünf Jahre einen Etat von 24,2 Mio. Euro (34,2 Mio. CAD) zur Verfügung gestellt, um Lachsbrutanstalten und Laichkanäle für den Wildlachsbesatz zu renovieren und zu modernisieren, meldet Fish Information & Services (FIS). Die Investitionen sind Teil des 36 Jahre alten Salmon Enhancement Programs (SEP). Ziel dieses Aufbauprogramms für die Wildlachsbestände in der Provinz British Columbia sei es, die Freizeit- und Erwerbsfischerei, aber auch die fischereilichen Möglichkeiten der Ureinwohner zu stärken. Das SEP unterhält 23 Lachs-Hatcheries, die jedes Jahr mehrere hundert Millionen Besatzfische produzieren.08.10.2014
Rewe: Neues Gastrokonzept "Oh Angie!"
Die Rewe startet mitten im Herzen von Berlin ein neues Gastronomiekonzept. Im Untergeschoss des Einkaufszentrums "The Q" direkt am Gendarmenmarkt entsteht ein neuer Marktplatz für Gastronomie und Lebensmittel, dessen Mittelpunkt das Restaurant "Oh Angie!" bildet. Hier bietet die Rewe in lockerer Atmosphäre sowohl mediterrane Küche als auch regionale Gerichte an. Die zum Teil tageszeitlich variierenden gesunden Gerichte werden frisch zubereitet, am Tisch serviert und sind ausschließlich für den Vor-Ort-Verzehr. Verwendet werden frische Rohzutaten und kontrolliert biologisch erzeugte Produkte. Das Angebot erstreckt sich vom Frühstück ab 9:00 Uhr über das Mittagessen bis zum Nachmittags-Kaffee und dem Abendessen mit anschließendem Drink an der Bar. " 'Oh Angie!' ist für uns der konsequente Schritt, in hochfrequentierten Lagen - in direkter Nachbarschaft oder integriert - unsere Supermärkte verstärkt zu sozialen Treffpunkten zu machen, wo unsere Kunden neben dem Lebensmitteleinkauf auch vom Außer-Haus-Verzehr profitieren können", sagte Oliver Mans, in der Geschäftsleitung von Rewe unter anderem für Einkauf und das Gastrokonzept "Oh Angie!" verantwortlich, anlässlich der Eröffnung.07.10.2014
Gosch gibt Filiale auf der Reeperbahn auf
Die Gosch-Filiale auf der Hamburger Reeperbahn ist zum 1. Oktober geschlossen worden. Damit ist der Fischgastronom nach nur eineinhalb Jahren aus den Räumlichkeiten des legendären Tanzcafés Keese wieder ausgezogen. Mit dem im März 2013 eröffneten Standort hatte Gosch die Party-Tradition von Keese fortführen und um maritime Spezialitäten bereichern wollen. Als erfahrener Gastronom und Geschäftsmann wusste Jürgen Gosch, dass auf der Reeperbahn spezielle Erfolgsgesetze gelten, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Zwar habe sich die Gosch-Filiale dort als stilvolle Ü-30-Eventlocation gut etablieren können, doch aufgrund sehr hoher Miet- und Betriebskosten sei die Bilanz der "sündigsten Fischbude der Welt", so die Eigenwerbung, nicht zufriedenstellend gewesen. Das Hamburger Abendblatt kolportiert eine Miethöhe von mehr als 20.000 Euro im Monat, die Gosch an seinen Vermieter, den bekannten Kiez-Investor Burim Osmani, gezahlt haben soll. Hamburg ist nach Sylt mit vier Gosch-Filialen weiterhin der zweitstärkste Standort. Das Unternehmen erzielte mit 39 Betrieben (+3), davon 28 Franchise-Outlets, zuletzt Umsätze von 68 Mio. Euro - ein Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um gut 17 Prozent.06.10.2014
Dänemark: Lachsproduzent Vega schreibt wieder schwarze Zahlen
Der dänische Lachsverarbeiter Vega Salmon ist im abgeschlossenen Finanzjahr dank neuer Kunden und Reorganisationsmaßnahmen in seiner deutschen Fabrik wieder in die Gewinnzone zurückgekehrt, schreibt das Portal IntraFish. Der Umsatz stieg in den zwölf Monaten Juli 2013 bis Juni 2014 um 63 % auf 76,7 Mio. Euro (2012/13: 47,1 Mio. Euro), der Bruttogewinn lag mit 4,1 Mio. Euro sogar 86 % über dem Ergebnis von 2,2 Mio. Euro im Vergleichszeitraum. Der Nettogewinn wies statt eines Minus' von 3,4 Mio. Euro ein Plus von 617.872 Euro aus. Die Bilanzaktiva stiegen von 23,2 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro. "Das Ergebnis wird als zufriedenstellend eingestuft", heißt es in einer Erklärung von Vega. Die bessere Performance habe mehrere Ursachen. Zum einen seien die im letzten Jahresbericht erwähnten Probleme am Produktionsstandort Handewitt bei Flensburg gelöst worden. So konnte der Betrieb seine IFS Higher Level-Zertifizierung in diesem Jahr erneuern. Neue Kunden trugen zu einer erheblichen Umsatzsteigerung um fast 30 Mio. Euro bei. Nicht zuletzt beeinflussten niedrigere Rohwarenpreise die Gewinnsituation.06.10.2014
Alaska-Pollack: Mehr PBO-Filets, weniger tiefenenthäutete Filets
Da die B-Fangsaison für den Alaska-Pollack Ende September nahezu abgeschlossen war, ist inzwischen absehbar, dass diese Saison erheblich mehr Surimi und Filets ohne Stehgräten (PBO - pinbone out) produziert wurden als tiefenenthäutete Filets, schreiben die Undercurrent News. Statistiken des US National Marine Fisheries Service notieren für Surimi mit 103.900 t ein Plus von 11% (2013: 93.300 t). Die Produktion von PBO-Filets liegt mit 80.700 t sogar 27% höher als in der Vorjahressaison mit 63.300 t. Demgegenüber wurden nur 23.800 t tiefenenthäutete Filets geschnitten - ein Minus von 28% im Vergleich zu den 33.300 t im Jahre 2013. Während die A-Saison 2013 noch mit einem Überhang bei PBO-Filets von rund 10.000 t begann, gebe es nach Angaben aus der Industrie derzeit keine PBO-Lagerüberhänge: "Wenn Sie jetzt zum Saisonende PBO von der US-Industrie kaufen wollen, können Sie froh sein, wenn Sie überhaupt noch ein paar hundert Tonnen bekommen." Als Hauptursache für die Verlagerung zugunsten der PBO-Produktion nennt ein Insider das veränderte Einkaufsverhalten der US-Fastfoodkette Burger King, die seit diesem Sommer statt tiefenenthäuteter Filets PBO-Filets für ihre Produkte verwende. Ein anderer Trend in dieser B-Saison sei das größere Interesse an nur einmal gefrorener Ware - sprich: die Nachfrage geht auf single frozen statt auf double frozen. Insgesamt wurden bis zum 20. September fast 1,4 Mio. t Alaska-Seelachs angelandet - mehr als 95% der Gesamtquote.06.10.2014
Indien alarmiert über EU-Zurückweisungen von Garnelen
Die Europäische Union hat jüngst eine Sendung von 24 Containern mit Vannamei-Garnelen aus Indien an der Grenze zurückgewiesen, weil die Shrimps aus dem Bundesstaat Andhra Pradesh eine zu hohe Belastung mit Antibiotika-Rückständen aufwiesen, zitiert die Zeitung The Hindu den Präsidenten der Federation of Indian Fishery Industries (FIFI), Y. G. K. Murti. Der Verbandsvertreter bemängelt, dass der Einsatz von Antibiotika in Indien unzureichend kontrolliert werde. Hatcheries, Setzlingslieferanten und die Züchter selbst würden Chloramphenicol und Nitrofuran verwenden. Die Situation gefährde Indiens Ziel, seine Seafood-Exporte im Wert von derzeit 4 Mrd. Euro bis 2020 im Wert auf 8 Mrd. Euro zu verdoppeln.06.10.2014
Schweiz: Große Fischzucht am Gotthard-Basistunnel geplant
Eine Fischzucht für die Produktion von bis zu 1.200 Tonnen Speisefischen soll am Nordportal des Gotthard-Basistunnels entstehen, meldet das Portal Schweizerbauer. Die auf Kosten von 25 bis 30 Mio. CHF - 21 bis 25 Mio. Euro - kalkulierte Anlage soll ab 2020 in den Betrieb gehen. Ähnlich wie am Lötschberg, wo das Tropenhaus Frutigen seine Fischzucht aus dem warmen Wasser eines Eisenbahntunnels speist, soll in Erstfeld (Kanton Uri) jenes Wasser Verwendung finden, das bei der Entwässerung des Gebirges durch den 57 Kilometer langen Gotthard-Tunnel mit einer Menge von 150 bis 400 Litern pro Minute aus dem Nordportal strömt. Allerdings liege die Wassertemperatur, die im Berg selber stellenweise bis zu 30 Grad Celsius betrage, am Austrittspunkt nur zwischen 14 und 16 Grad. Noch in diesem Jahr will die Betreiberin der Zucht, die von 25 Urnern gegründete "Basis 57 nachhaltige Wassernutzung AG", eine Laboranlage in Betrieb nehmen. In der späteren, überdachten Aquakulturanlage mit bis zu 25 Arbeitsplätzen sollen vor allem Zander und Schalentiere, aber auch weniger bekannte einheimische Speisefische wie Trüschen, Äschen und Huchen produziert werden. Für das Fischfutter ist die Kooperation mit örtlichen Lieferanten geplant, außerdem sollen den Bauern in der Region Fische für die Aufzucht überlassen werden.02.10.2014
Ecuador: Erste Shrimp-Zucht weltweit erhält ASC-Zertifizierung
Der ecuadorianische Garnelen-Exporteur Omarsa ist als erster Shrimp-Produzent weltweit nach den Standards des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) als nachhaltig zertifiziert worden, teilt der ASC mit. Die ersten Produkte mit ASC-Label sollen in den kommenden Wochen in Skandinavien auf den Markt kommen. Nach einer Prüfung durch das Institut für Marktökologie (IMO) waren die Farmen Camaronera Cachugran, Camaronera Chongon und Camaronera Puna als verantwortungsbewusst und gut gemanaged bewertet worden. Um dieses Ziel zu erreichen, habe man "hart gearbeitet", sagt Omarsa-Geschäftsführer Sandro Coglitore: "So haben wir einiges unternommen, etwa Projekte zur Mangroven-Aufforstung. Omarsa engagiert sich für eine verantwortungsbewusste Aquakultur und wir investieren ständig, um unsere Shrimp-Zuchten zu verbessern." Um das Farm-Management zu optimieren habe man mit Blueyou Consulting zusammengearbeitet. Finanziell wurde die Zertifizierung aus Fördergeldern des Fonds IDH Farmers in Transition (FIT) unterstützt. Omarsa, das ehemals 60 Prozent seiner Garnelen nach Europa exportierte, verkauft inzwischen 50 Prozent seiner Produktion nach China und noch 35 Prozent in die EU, vor allem nach Deutschland, Frankreich und in die Schweiz.01.10.2014