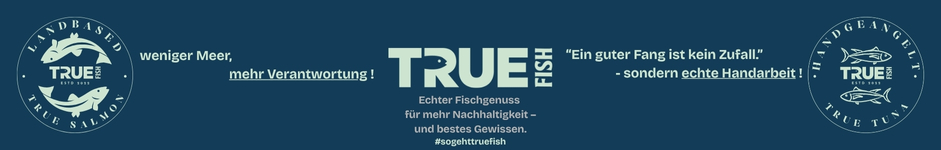14.05.2010
Chile: Impfstoff gegen Lachsseuche ISA vorläufig zugelassen
Die chilenischen Behörden haben am Dienstag erstmals einen Fünf-Komponenten-Impfstoff gegen die Lachsseuche ISA zugelassen, meldet Fish Information & Services (FIS). Das Produkt Alpha Ject 5-1 von dem Hersteller Pharmaq biete Schutz gegen die drei bakteriellen Erkrankungen SRS (Salmon Rickettsia Syndrome), Furunkulose und Vibriose sowie die Viruskrankheiten IPN (Infektiöse Pankreas-Nekrose) und ISA (Infektiöse Salm-Anämie). Schon im April hatte Pharmaq für den ISA-Impfstoff Alpha Ject micro 1 eine vorläufige Zulassung erhalten. Bis jetzt habe der Hersteller 6,5 Mio. USD für Forschung und Entwicklung im Rahmen seines ISA-Projektes investiert.13.05.2010
Vietnam: Erste Pangasius-Zucht erhält Friend of the Sea-Zertifikat
Erstmals ist in Vietnam eine Pangasius-Farm gemäß den Nachhaltigkeits-Kriterien der Naturschutz-Organisation Friend of the Sea (FOS) zertifiziert worden, teilt FOS-Vertreter Heinzpeter Studer mit. Sechs Monate nach einem zunächst negativen Audit durch eine unabhängige Zertifizierungsorganisation hat eine Farm der vietnamesischen Fischzuchtgruppe Agifish dank zahlreicher Verbesserungen das FOS-Zertifikat für nachhaltige Produktion erhalten. Die Pangasiusfilets werden von dem international tätigen Schweizer Handelskonzern DKSH vermarktet. „Die FOS-Zertifizierung für Pangasius ist ein Meilenstein in der vietnamesischen Fischzucht“, ist Thomas Schefer, Seafood-Verantwortlicher bei DKSH für Europa, überzeugt. Die von FOS geforderten Verbesserungen der Farm bezogen sich u.a. auf Sicherheitsmaßnahmen, Vorbeugung gegen Gewässerverschmutzung und Überwachung der Wasserparameter. FOS-Direktor Paolo Bray hofft, dass die Pionierrolle der Agifish-Farm weitere Pangasius-Züchter in Vietnam motivieren werde, ihre Produktion nachhaltiger zu gestalten.12.05.2010
Cuxhaven: Krabbenschälzentrum kündigt erneut Produktionsbeginn an
In der kommenden 20. Kalenderwoche soll im Cuxhavener Krabbenschälzentrum mit dem Probebetrieb begonnen werden. Das zumindest hatte Geschäftsführer Gregor Kucharewicz am gestrigen Dienstag gegenüber den Cuxhavener Nachrichten geäußert. Einen Tag zuvor seien die ersten zwei Schälmaschinen mit dem entsprechenden Zubehör eingetroffen. In der nächsten Woche würden sie installiert und auf die zu verarbeitenden Krabben eingestellt. Wie es weitergeht, vermochte Kucharewicz nicht zu sagen. Das Schälzentrum hatte die zunächst für August 2008 angekündigte Betriebsaufnahme immer wieder verschoben.12.05.2010
Fernsehen: Drehstart zu einer Komödie um den Krabbenhandel
Im ostfriesischen Greetsiel und in Marokko (Tanger) haben gestern die Dreharbeiten zu einer ZDF-Fernsehkomödie begonnen, die um den Krabbenhandel kreist, teilt der Sender mit. Vor dem Hintergrund, dass friesische Krabben nach dem Fang mit Kühl-Lkw nach Marokko transportiert, dort gepult und wieder zurückgefahren werden, hat Drehbuchautor Daniel Speck, preisgekrönter Spezialist für Integrations- und Migrations-Komödien („Meine verrückte türkische Hochzeit“, „Maria, ihm schmeckt s nicht“) eine originelle und liebevoll erzählte Geschichte zum Thema Integration mit Hindernissen entwickelt - Arbeitstitel: „Fischer fischt Frau“. Der eher wortkarge Krabbenfischer Hein Schüpp (Peter Heinrich Brix) verliebt sich in die junge marokkanische Krabbenpulerin Mona (Sanaa Alaoui), die er in Tanger kennengelernt hat. Sie erwidert die Zuneigung und folgt ihm in sein ostfriesisches Fischerdorf, ohne zu wissen, dass Hein mit seiner Ex-Frau Rieke (Anna Loos) noch nicht reinen Tisch gemacht hat. Peter Heinrich Brix und Regisseur Lars Jessen stehen als bewährtes Team für eine authentische und populäre Umsetzung norddeutscher Komödien: Ihr Film „Butter bei die Fische“ erreichte im September 2009 mehr als sechs Millionen Zuschauer (19,4 Prozent Marktanteil). Die Dreharbeiten für die neue Produktion dauern voraussichtlich bis zum 11. Juni 2010, ein Sendetermin steht noch nicht fest.11.05.2010
Golf von Mexiko: Verlust der Shrimp-Fischerei beeinflusst Weltmarkt kaum
Für Fischer und Fischwirtschaft entlang der Golfküste hat die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko dramatische Folgen - der Weltmarkt für Garnelen hingegen wird die Ausfälle aus der Region kaum spüren, schreibt das Portal IntraFish. „Selbst wenn wir davon ausgehen, dass die Produktion dort zu 100 Prozent ausfällt, dann sind das 34.000 Tonnen (75 Mio. lb) oder fünf Prozent des jährlichen Verzehrs in den USA“, schätzt ein US-Industrieller, der nicht genannt werden will. Diese Lücke könne in der Regel problemlos durch Importe aus Asien und Lateinamerika gefüllt werden. Thailand beispielsweise, führender Shrimp-Produzent in Asien, wolle seine Produktion von 540.000 t im vergangenen Jahr auf 570.000 bis 580.000 t in diesem Jahr anheben. Das Land ist führender Garnelenlieferant für den US-Markt: im vergangenen Jahr lieferte Thailand in die USA 176.870 t Shrimp-Produkte. Zum Vergleich: aus Indonesien kamen 90.000 t.11.05.2010
Schwarzer Seehecht: Einspruch gegen MSC-Verfahren
Der unabhängige Schiedsrichter Michael Lodge hat eine Überprüfung der ins Auge gefassten Zertifizierung der Fischerei auf den Schwarzen Seehecht verlangt, teilt der Marine Stewardship Council (MSC) mit. Lodge, Rechtsanwalt und vom MSC selbst schon 2006 als erster Juror der Organisation berufen, erklärte, der von dem Zertifizierer Moody Marine gewählte Bewertungsansatz enthalte „ernsthafte prozessuale Fehler“. Lodge gründet seine Überzeugung auf eine Beschwerde der Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC), die schon im Dezember vergangenen Jahres Einspruch erhoben hatte gegen die Empfehlung seitens Moody Marines, Teile der Seehecht-Fischerei im Rossmeer zu zertifizieren. Die ASOC, ein globaler Zusammenschluss von Umweltschutzorganisationen zum Schutz der Antarktis, kritisiert zum einen, dass es über den „in hohem Maße gefährdeten Bestand“ schlicht zu wenig Informationen gebe. Deshalb spreche die „Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources“ (CCAMLR), die die Fischerei im südlichen Ozean manage, auch nur von einer „Forschungsfischerei“. Die ASOC vermisse bei der Überprüfung das notwendige Maß an wissenschaftlicher Strenge, so dass eine Zertifizierung nicht gerechtfertigt sei. Das Bündnis wies außerdem darauf hin, dass Moody Marine die Meinung seiner eigenen Experten ignoriert habe. Eine Gruppe von 39 Meereswissenschaftlern aus sieben Nationen, die seit Jahrzehnten in der Ross Sea arbeiten, hatte erklärt, vom wissenschaftlichen Standpunkt aus sei eine Zertifizierung des Schwarzen Seehechts nicht vertreten.10.05.2010
Norwegen: Lachspreis steigt im April auf Vier-Jahres-Hoch
Norwegen hat im April Lachs im Wert von 255,5 Mio. € exportiert. Das sind auf der Basis Wert 20 Prozent mehr als im April 2009, während die Ausfuhrmenge 540 t oder ein Prozent niedriger lag als im Vergleichsmonat des Vorjahres, meldet Fish Information & Services (FIS) unter Berufung auf den Norwegischen Seafood-Exportrat (NSEC). Entsprechend war der monatliche Durchschnittspreis für frischen ganzen Lachs im April mit 4,97 €/kg der höchste seit Juni 2006, als er auf 5,31 €/kg geklettert war. Damit lag er 0,88 €/kg höher als im April 2009 und noch 0,36 €/kg über dem März-Preis 2010. In zahlreichen Märkten wurde mehr Lachs gekauft als im April 2009. Der Ausfuhrwert nach Russland stieg um 52 Prozent auf 10,1 Mio. €, nach Deutschland um 46 Prozent, nach Polen um 42 Prozent und in die USA um 33 Prozent. Rückläufig war hingegen der Export von Meerforelle, der mit einem Gesamtwert von 14,1 Mio. € gute 34 Prozent niedriger lag als im April 2009, auf Basis Wert sogar 55 Prozent gefallen war. Wichtigster Markt hierfür ist Russland, gefolgt von China, Thailand und Weißrussland.10.05.2010
Dänemark: „Hering des Jahres 2010“ mit Chili und Heidehonig
Das Restaurant ‚Lilleheden’ im dänischen Hirtshals hat den diesjährigen Preis „Hering des Jahres 2010“ erhalten, meldet die dänische Botschaft in Berlin. Aus fünf verschiedenen Heringsprodukten, die zum Thema „Hering zu jeder Zeit“ eingereicht worden war, wählten die Preisrichter die Rezeptur des Gastronomen Ejvind Jensen. Grundlage ist ein von dem Heringsverarbeiter Lykkeberg in Salz, Zucker und Essig marinierter Hering, den der Sieger mit einer sorgfältig dosierten Mischung aus Aprikose, Vanille, Schalotten, Ingwer, Chili und Heidehonig verfeinerte. Schon in diesem Monat soll das Produkt im dänischen Lebensmittelhandel erhältlich sein. Der Wettbewerb wurde zum 16. Mal vom Nordsoen Oceanarium und Hirtshals Kulinariske Sildeslag verliehen. Die diesjährige fünfköpfige Jury setzte sich zusammen aus der dänischen Außenministerin Lene Espersen, Schauspieler Per Pallesen, Küchenchef Kristian Rise vom Brauhaus Vendia in Hjoerring, dem Gastwirt Thomas Riis vom Restaurant Messen in Skallerup Klit sowie als Vorsitzendem dem früheren Auktionator in Hirtshals, Knud Damsgaard.10.05.2010
Mexiko: Thunfischerei vor Baja California startet Zertifizierung
Die mexikanische Fischerei auf Gelbflossen-Thun (Thunnus albacares) und auf Echten Bonito (Katsuwonus pelamis) von Baja California ist in das Hauptbewertungsverfahren nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) eingetreten. Ganzjährig fangen dort vor der Küste des nordwestlichsten mexikanischen Bundesstaats in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) des Landes zwei Fangschiffe mit pole and line rund 555 t (2008). Bisher wurde der Thun im Hafen von Matancitas zu Konserven verarbeitet und in Mexiko verkauft. Antragsteller für die Zertifizierung ist Productos Pesqueros de Matancitas S.A.07.05.2010