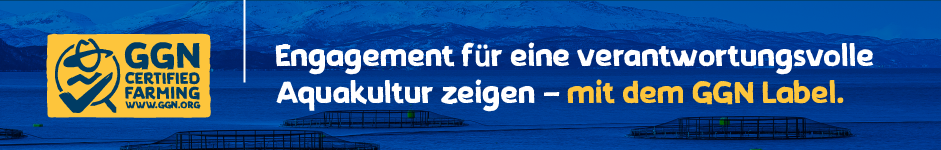12.10.2012
Migros übernimmt Tegut-Märkte mit rund 70 Frischfischtheken
Die deutsche Supermarktkette Tegut wird vom Schweizer Handelsriesen Migros übernommen. In den mehr als 300 Tegut-Märkten – überwiegend in Hessen, Thüringen und Nordbayern – arbeiten etwa 6.300 Menschen. Die Unternehmensgruppe mit Sitz in Fulda erzielte 2011 einen Umsatz von rund 1,16 Milliarden Euro. Den Kaufpreis gaben die Partner vorerst nicht bekannt. „Expansion in der Schweiz ist für die Migros nur noch bedingt möglich“, sagte Unternehmenschef Edi Class in Zürich. Zugleich wachse der Lebensmittelhandel in Deutschland stärker als in der Schweiz. Der Kauf beschränkt sich den Angaben zufolge auf das Handelsgeschäft von Tegut. Das Industrie- und Landwirtschaftsgeschäft bleibt damit in den Händen der Familie Gutberlet. Das Unternehmen war 1947 von Theo Gutberlet unter dem Namen Thegu gegründet worden. Der heutige Tegut-Chef Wolfgang Gutberlet erklärte, die Philosophie beider Handelsunternehmen sei sehr ähnlich. Der Firmenname Tegut soll dem Vernehmen nach in Deutschland erhalten bleiben. Das Sortiment der Tegut-Märkte könnte aber erweitert und an das der Migros angepasst werden. Die Migros betreibt in Deutschland aktuell 5 Häuser mit Frischfischtheke. Tegut betreibt derzeit etwa 70 Theken.10.10.2012
TST eröffnet neues Werk für Tiefkühlfisch in Riepe
Es ist die wohl modernste Fischfabrik Europas: Gäste aus der ganzen Welt haben am 8. Oktober in Riepe (Landkreis Aurich) die Eröffnung der 15.000 Quadratmeter großen Produktionsstätte von 'The Seafood Traders' (TST) gefeiert. Ohne Beihilfen von Bund oder Land wurden in Riepe von der Leuchtturm-Holding 40 Millionen Euro investiert und aktuell 65 Arbeitplätze geschaffen. Finnbogi Baldvinsson, ehemaliger Geschäftsführer der Icelandic-Gruppe sowie von Pickenpack, jetzt Kopf der Leuchtturm-Holding, hat sich mit dem Branchenriesen Nissui aus Japan zusammengetan, um das Vorhaben zu stemmen.09.10.2012
Norwegen: Mainstream will Lachs-Produktion in der Finnmark verdoppeln
Der Lachsproduzent Mainstream, Tochterunternehmen von Cermaq, will seine Produktionsmenge in der norwegischen Finnmark von zuletzt 16.000 t (2011) in zwei Jahren auf 32.000 t (2013) verdoppeln, schreibt das Portal IntraFish. Da die Produktionskosten in Norwegens nördlichster Region mit 2,- Euro je Kilo Rundgewicht Lachs 0,27 Euro über den durchschnittlichen Kosten von Mainstream im Nordland liegen, will der Züchter sie in kurzer Zeit um 0,13 Euro senken, kündigt Geschäftsführer Geir Molvik an. Er weist außerdem darauf hin, dass Analysten bei der Kalkulation des Betriebsgewinns (EBIT) je Kilo nicht berücksichtigten, dass die Lizenzkosten in der Finnmark günstiger seien: "Wenn Sie das mit kalkulieren, sehen die Summer wesentlich günstiger aus." Molvik ergänzt: "Wenn Sie an die Theorien von der globalen Erwärmung glauben, dann ist die Finnmark eine gute Investition."08.10.2012
Island: Junge Generation isst erheblich weniger Fisch
Junge Isländer essen nur noch ein Drittel der Fischmenge, die ältere Menschen auf der Insel jährlich konsumieren, schreibt die Icelandic Review. Einem Artikel der medizinischen Fachzeitschrift Læknablaid zufolge ist der Verzehr von Fisch und Fischöl auf Island innerhalb der beiden letzten Generationen beträchtlich gesunken. Die Autorin des Artikels, die Kardiologin Margrét Leósdóttir, hat festgestellt, dass unter den 18- bis 30-jährigen Isländern 41 Prozent der Männer und 45 Prozent aller Frauen nur noch ein Fischgericht pro Woche essen, weniger als einmal pro Woche oder niemals. Höher als der Verzehr von Fisch sei der Verzehr von Fischölprodukten. Als beunruhigend wertet Leósdóttir, dass gleichzeitig eine Verfettung der Kinder zu beobachten sei. Ein Viertel aller Neunjährigen in Islands Hauptstadt Reykjavík ist übergewichtig, heißt es in einer neuen Erhebung der Schulbehörde. Demnach sind 4,8 Prozent der Kinder zu fett und weitere 18,5 Prozent stark übergewichtig, was zusammen mehr als 23 Prozent entspreche. Zum Vergleich: im Jahre 1958 waren weniger als ein Prozent dieser Altersklasse übergewichtig und 6,6 Prozent lagen über dem Idealgewicht, im Jahre 1998 waren 5 Prozent zu dick und 23,7 Prozent überschritten das Idealgewicht.05.10.2012
Österreich: Elfin ruft 280 ml King Prawns zurück
Der oberösterreichische Feinkosthersteller Elfin (Leonding) hat im Zuge der Eigenkontrollen bei dem Produkt King Prawns in Knoblauchöl (280 ml-Becher, L 2372) einen erhöhten Gehalt an Listeria monocytogenes festgestellt. Da Listerien in erhöhter Anzahl zu einer Gesundheitsschädigung führen können, hat Elfin Feinkost das Garnelen-Produkt zurückgerufen, meldet die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES).05.10.2012
Hamburg: Aldi Nord warnt vor Lachssalat
Aldi Nord hat wegen Salmonellen-Verdachts einen Lachssalat aus den Niederlanden aus den Regalen genommen, meldet das Hamburger Abendblatt. Bei dem Salat von "Johma Salades B.V." (150 Gramm) könne eine Verunreinigung mit Salmonellen nicht ausgeschlossen werden. Die Verbraucher können die Packungen zurückbringen, der Kaufpreis werde von Aldi erstattet. Die Verzehrwarnung steht offensichtlich im Zusammenhang mit dem Auftreten von Salmonellen bei der ebenfalls holländischen Lachs- und Aal-Räucherei Foppen. Mit Datum vom 28. September hatte Johma mitgeteilt, "dass unsere Johma-Salate nicht infiziert" seien. Das habe auch die Niederländische Behörde für Lebensmittel- und Produktsicherheit (NVWA) bestätigt.04.10.2012
Neue 'ZG-Fisch' will Fischhändlern MSC-/ASC-Zertifizierung erleichtern
Wer auf der Internetseite des MSC einen Fischhändler mit MSC-Zertifizierung sucht, hat Probleme: unter der Rubrik "Wo kaufen" finden sich zwar eine B2B-Lieferantendatenbank, eine Liste von Produkten des Lebensmitteleinzelhandels sowie zertifizierte Restaurants - jedoch keine Liste entsprechender Fischfachhändler. Ein Grund: der zeitliche, personelle und finanzielle Aufwand für eine solche Zertifizierung stellt für kleine Unternehmen oft eine Hürde dar. Deshalb soll jetzt eine neue "ZG-Fisch" - eine Zertifizierungsgruppe für Fischfachhändler und Restaurants - diesen Betrieben den Zugang zur MSC- und ASC-Zertifizierung erleichtern und kostengünstiger gestalten, meldet der MSC. "Es muss nicht jeder das Rad neu erfinden, wenn es in Form einer Gruppenleitung eine zentrale Stelle geben kann, die das System pflegt und für die Umsetzung durch die einzelnen Teilnehmer sorgt", meint Ulf Sonntag, Initiator und Gründer der ZG-Fisch. Der Consultant ist Fachmann für Rückverfolgungsstandards und verfügt über langjährige Erfahrungen als Auditor und Gruppenmanager.04.10.2012
Heiploeg: Jan Ernst Veenman nicht mehr Geschäftsführer
Jan Ernst Veenman ist als Geschäftsführer des niederländischen Garnelen-Lieferanten Heiploeg zurückgetreten, melden holländische Zeitungen. Übergangsweise übernimmt Jasper Schrijver von der Handelsbank ABN AMRO die Geschäftsführung. ABN AMRO hatte im Sommer diesen Jahres gemeinsam mit der Rabobank, der Friesland Bank und der isländischen Bank Landsbanki Heiploeg vom niederländischen Investmentfond Gilde Buy-Out übernommen.02.10.2012
Niederlande: 300 Krankheitsfälle durch Salmonellen in Räucherlachs
Mindestens 300 Menschen sollen seit Ende Juli nach dem Verzehr von Räucherlachs aus den Niederlanden, der mit Salmonellen infiziert war, erkrankt sein, melden holländische Zeitungen. Produzent ist die holländische Lachs- und Aalräucherei Foppen. Nachdem die Salmonellen-Belastung Ende vergangener Woche in den Medien gemeldet worden war, hat Foppen 100.000 Packungen aus dem Handel zurückgerufen. Nach Angaben der Niederländischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz (NVeW) wurde der Räucherlachs sowohl über LEH-Filialisten wie Albert Heijn, Aldi, Makro, HEMA, Coop, Spar, Boni und DekaMarkt vertrieben wie auch über Großhändler und Fischfachhändler. Auch in den USA soll bei rund 100 Menschen der Erreger Salmonella thompson diagnostiziert worden sein, teilt eine Sprecherin der Niederländischen Gesundheitsbehörde (RIVM) mit: Foppen ist Lieferant für Costco, den - nach Angaben von IntraFish - größten Lachshändler in den USA. Die Produktion in allen drei Werken von Foppen - zwei im niederländischen Harderwijk und eines in Griechenland - liege derzeit still, schreibt heute das Eindhoven Dagblad. Da die Behörden in Harderwijk keine Salmonellen gefunden haben, werden die Keime in sechs Produktionslinien in Griechenland vermutet. Eine Salmonellen-Erkrankung dauert in der Regel etwa vier bis sieben Tage, wobei die meisten Menschen ohne ärztliche Behandlung genesen.02.10.2012
USA: Wissenschaftler und Investoren wollen von Obama Genlachs-Entscheidung
Mehr als 50 führende US-amerikanische Wissenschaftler und Unternehmer haben in einem Schreiben US-Präsident Barack Obama aufgefordert, die Lebensmittelbehörde des Landes - die FDA - zu einer Stellungnahme zum so genannten Genlachs zu zwingen, schreibt das Portal IntraFish. Die Diskussion um den gentechnisch veränderten Lachs - den "GM salmon" - wird in den USA seit mehr als einem Jahrzehnt geführt. Vor zwei Jahren hatte die Food and Drug Administration (FDA) den Verzehr des Fisches als unbedenklich eingestuft. Jetzt stehe nur noch die Veröffentlichung einer Umweltbewertung aus, in der detailliert die Bedingungen beschrieben werden sollen, unter denen der Produzent AquAdvantage den genetisch modifizierten Lachs züchten darf. Im vergangenen Jahr hatte der Harvard-Professor Calestous Juma vor dem US-Kongress erklärt, dass die Verzögerung der gesamten Welt den Eindruck vermittele, die wissenschaftsbasierte Kontrollfunktion der FDA könne durch politische Intervention ausgehebelt werden. Da es für das FDA-Verfahren keinen Zeitrahmen gebe, werde eine Industrie, die sich für wirtschaftliches Wachstum, Innovation, Wettbewerb und die Schaffung von Arbeitsplätzen in den USA stark mache, in ihrer Entwicklung gehemmt. Das von mehr als 50 Persönlichkeiten unterzeichnete Schreiben fordere Präsident Obama deshalb auf, die FDA anzuweisen, die Untersuchungsergebnisse zu den ökologischen Risiken des AquAdvantage-Lachses umgehend zu publizieren.- Heinrich Abelmann
- Bremerhaven
- Listerien
- Rückruf
- Bratheringshappen in ...
- Hering in ...
- Kräuterfilets ...
- Bundesamt fü...
- Clemens Dittmeyer
- Dittmeyer’s ...
- Austern
- List auf ...
- Sylt
- Pauline Dittmeyer
- Sylter Royal
- Thomas Neudecker
- Pazifische Felsenauster
- Fischfachgeschäft
- Fischfachhandel
- Fisch Mü...
- Goldbach
- Aschaffenburg
- Franken
- Martin Vö...
- Sabine Vö...
- Seafood Ecosse
- Macduff Shellfish