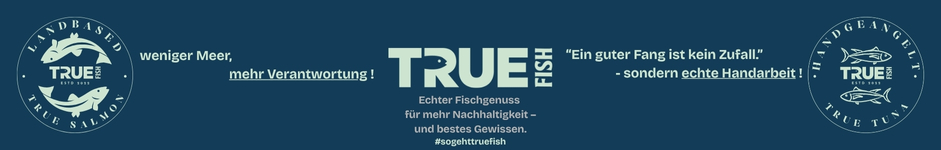16.11.2018
Unternehmensgruppe Theo Müller: Heiner Kamps verlässt Aufsichtsrat
Heiner Kamps will zum Jahresende aus dem Aufsichtsrat der Unternehmensgruppe Theo Müller (UTM) ausscheiden und verstärkt wieder eigenständig als Unternehmer arbeiten, meldet die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Im Gespräch sei ein erneutes Engagement als Großbäcker. Der inzwischen 63-jährige Kamps und Theo Müller arbeiten seit 13 Jahren zusammen. Zueinandergeführt hatte die beiden die Fischrestaurantkette Nordsee: 2005 kaufte Kamps den Filialisten mit Geld von Theo Müller. 2007 folgte das Feinkostunternehmen Homann. Während der Zeit ihrer Zusammenarbeit habe sich der UTM-Umsatz auf mehr als 6 Mrd. Euro mehr als verdoppelt, schreibt die LZ.16.11.2018
Feinkost: Popp holt auf
Im deutschen Feinkostmarkt positioniert sich Popp als Zweitplatzierter zunehmend stärker gegenüber dem Marktführer Homann. Obgleich Homann mit einem Marktanteil von 8% in der Kernkategorie Feinkostsalate (980 Mio. Euro Gesamtumsatz) deutlich die Spitzenposition einnimmt, blieb der Zuwachs der Dissener beim Endverbraucherumsatz mit knapp 3% hinter der Marktentwicklung zurück, schreibt die Lebensmittel-Zeitung (LZ). Popp spielte nach Recherchen der Marktforscher zwar weniger als die Hälfte des Homann-Umsatzes ein, dafür aber ein Plus von beachtlichen 26%. Im Segment Brotaufstriche sieht Nielsen die Marke Popp mit einem Anteil von knapp 50% am Gesamt- und fast 85% am Markenumsatz als eindeutige Nummer eins. Offenbar "diskontiert" Popp, um Volumen für die Marke zu gewinnen. Jetzt reagiert Homann mit einer "Offensive", die von Experten jedoch als "sinnvoll, aber wenig innovativ" bewertet wird: transparente Verpackungen, eine flexiblere Produktion mit kleineren Losgrößen und die angekündigte Etablierung eines Verantwortlichen für die Sparte Feinkostsalate auf höchster Ebene. "Klar ist jedoch auch: Für Trendsegmente greift der LEH verstärkt auf andere Lieferanten zurück", schreibt die LZ, darunter Natsu und Kühlmann im To-go-Regal und Matiss für das Orient-Segment.16.11.2018
Rostock-Bentwisch: Thai Union eröffnet Raffinerie für Thunfisch-Öl
Der thailändische Lebensmittelkonzern Thai Union hat in Rostock-Bentwisch eine neue Fischöl-Raffinerie eingeweiht, meldet die Ostsee-Zeitung (OZ). Nach einem Veterinär-Audit soll Anfang Dezember die Produktion von täglich 20.000 Litern raffiniertem Thunfischöl beginnen, das den Herstellern von Babynahrung weltweit angeboten werden soll, sagt Betriebsleiter Philipp Schröder (31). Das Ausgangsprodukt stammt aus einer im Februar in Thailand eröffneten Fabrik, wo aus Thunfisch-Köpfen Rohöl gewonnen wird. Dieses gelangt auf dem Schiffsweg zur weiteren Verarbeitung nach Deutschland. Hier hat die Thai Union, Muttergesellschaft der Fischverarbeiter Rügenfisch und Ostseefisch, in 15 Monaten Bauzeit in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ostseefisch für 20 Mio. Euro eine Raffinerie gebaut. Dort wird das Öl zunächst neutralisiert, das heißt freie Fettsäuren werden abgetrennt, so dass nur noch die kurzen Omega 3-Säure-Moleküle übrig bleiben, erläutert Projektleiter Michael D'heur. Anschließend werden Verunreinigungen und Schadstoffe entfernt, das Öl aufgehellt und gebleicht und schließlich werden dem Produkt in einer 14 Meter hohen Deodorisationssäule die letzten Stoffe entzogen, die Geruch erzeugen könnten.15.11.2018
Island: Bjørn Hembre wird neuer Arnarlax-Geschäftsführer
Der Mitgründer und bisherige Geschäftsführer des isländischen Lachszüchters Arnarlax, Kristian B. Matthiasson, tritt zum Januar 2019 zurück und wird Mitglied des Vorstandes der norwegischen Muttergesellschaft SalMar, meldet IntraFish. Dort wird er Nachfolger seines Vater Matthías Gardarsson, des Gründers von Arnarlax. Als neuer Arnarlax-CEO wurde Bjørn Hembre berufen, der seine Tätigkeit zum Jahresanfang 2019 aufnehmen wird. Der Biologe habe als Manager von Lachsfarm-Unternehmen in Norwegen umfassende Erfahrung erworben.15.11.2018
Bremen: Besucher-Plus für Messe Fisch & Feines
Die Bremer Fachmesse Fisch & Feines vom 9. bis 11. November 2018 registrierte dieses Jahr mehr als 39.000 Besucher - ein Plus von 1.000 Gästen gegenüber dem Vorjahr. Gut besucht waren Events wie die Fischauktion, Austern, Krabben & Nordseefisch, aber auch das Craft Beer Event und das Kaffee-Spezial, teilt Andrea Rohde mit, Bereichsleiterin Fachmessen und Special Interest der Messe Bremen. Die nächste Fisch & Feines findet von Freitag, den 8., bis Sonntag, den 10. November 2019 statt.15.11.2018
Kaufland: Tiefkühl-Eigenmarken jetzt alle mit ASC- oder MSC-Siegel
Kaufland bietet als erster Lebensmittelhändler bundesweit in allen über 660 Filialen bei seinem kompletten Tiefkühl-Eigenmarkensortiment nur noch ASC- und MSC-zertifizierten Fisch und Garnelen an. "Wir freuen uns, dass wir als Erster diese tolle Botschaft für die Branche verkünden können", sagt Sebastian Schlag, Geschäftsleitung Kaufland Eigenmarken. Das Sortiment umfasst rund 30 Artikel, die dauerhaft im Sortiment sind, wie Knusper- und Schlemmerfilets, Fischstäbchen, Garnelen und Lachsfilet sowie Saisonartikel. "In den Zielen und Prozessen bei Kaufland ist das Engagement im Bereich Nachhaltigkeit (CSR) tief verankert," heißt es in einer aktuellen Pressemitteilung. Die Initiative "Machen macht den Unterschied" spiegele die Haltung und die Identität von Kaufland wider. Der LEH-Filialist bietet mit durchschnittlich 30.000 Artikeln ein großes Sortiment an Lebensmitteln an. Dabei liegt der Fokus auf den Frischeabteilungen, darunter auch für Fisch. Kaufland mit Sitz in Neckarsulm (Baden-Württemberg) ist Teil der Schwarz-Gruppe, die zu den führenden LEH-Unternehmen in Deutschland gehört.14.11.2018
Norwegen: Marine Harvest plant Namensänderung und Rebranding
Marine Harvest (MH) will seinen Namen in Mowi ändern und eine weltweite Marke gleichen Namens etablieren, meldet IntraFish. "Dieser Vorschlag ist abhängig von der Zustimmung der Aktionäre bei einem Treffen am 4. Dezember, aber wenn dem zugestimmt wird, heißt das Unternehmen ab dem 1. Januar kommenden Jahres nicht mehr Marine Harvest", teilte Ola Helge Hjetland, MH-Direktor Kommunikation, IntraFish mit. Marine Harvest war ursprünglich vor mehr als 50 Jahren von norwegischen Aquakultur-Pionieren unter dem Namen Mowi gegründet worden. Jetzt will der weltweit führende Lachsproduzent eine Sortimentslinie unter der Marke Mowi zunächst in ausgewählten Märkten vorstellen. "Ich bin sehr gespannt, dass wir das Unternehmen jetzt auf eine neue Stufe heben", meint Marine Harvest-Geschäftsführer Alf-Helge Aarskog, "durch Einführung unserer Mowi-Markenstrategie können wir unsere vertikal voll integrierte Produktkette vom Futter bis auf den Teller des Verbrauchers kommunizieren." Für die sukzessive Etablierung der Marke Mowi kalkuliere MH mit Kosten in Höhe von 35 Mio. Euro.13.11.2018
Holland: Anova tritt TK-Segment an Seafood Connection ab
Die holländischen Produzenten und Trader Anova Seafood (Umsatz: 100 Mio. Euro) und Seafood Connection (Umsatz: 170 Mio. Euro) haben beschlossen, im Rahmen eines "strategischen Transfers" die Anova-Segmente TK-Produktion und -Verkauf auf das letztgenannte Unternehmen zu übertragen, meldet IntraFish. Anova ist in den letzten Jahren zu einem wichtigen europäischen Akteur sowohl in der Frische als auch für gefrorene Seafood-Produkte geworden. Die Produkte werden unter den eigenen Marken "Anova", "Sea & We" und "Del Mare" vertrieben wie auch unter mehreren Handelsmarken. In den kommenden Jahren will sich Anova stärker spezialisieren und auf seine Kernkompetenzen frische und gekühlte Produkte konzentrieren, und zwar beginnend zum kommenden Jahr. Das teilten die beiden Inhaber Constant Mulder und Willem Huisman mit. Seafood Connection wiederum, seit 2013 Teil des japanischen Seafood-Konzerns Maruha Nichiro, liefert europaweit ein breites Sortiment an TK-Seafood an LEH, Foodservice, Großhändler und weiterverarbeitende Unternehmen. "Wir sehen in der Aufnahme von Anovas Produktportfolio eine Menge Potential", kommentierte SeaCon-Geschäftsführer Jan Kaptijn den Transfer.13.11.2018
Alaska: Alexa Tonkovich verlässt das ASMI
Alexa Tonkovich, geschäftsführende Direktorin des Alaska Seafood Marketing Institutes (ASMI) seit dem Jahre 2015, verlässt die Organisation, um zu studieren, meldet IntraFish. Sie hatte beim ASMI 2009 als internationale Direktorin begonnen. Am 19. November will der ASMI-Vorstand zunächst einen kommissarischen Geschäftsführer benennen.09.11.2018