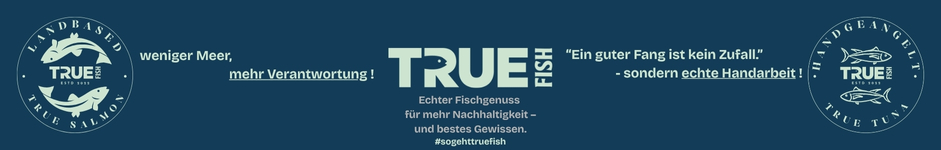22.10.2019
Spanien: Mercadona verkauft Caladero an Profand
Die größte Supermarktkette in Spanien, Mercadona, hat ihre Fischverarbeitung Caladero an die galizische Grupo Profand verkauft, ein führendes Fischereiunternehmen des Landes, meldet das Portal der spanischen Regionalzeitung Las Provincias (Valencia). Caladero ist der größte Hersteller von Fisch und Seafood in MAP-Verpackungen. 2018 produzierten in dem Werk in Saragossa (Fläche: 55.000 qm) 600 Beschäftigte rund 45 Mio. MAP-Schalen (Produktgewicht: 21.000 t), der Jahresumsatz lag bei 200 Mio. Euro, der Reingewinn bei 3,4 Mio. Euro. Mercadona hatte Caladero 2010 mit der Absicht übernommen, das Unternehmen effizienter zu gestalten, an die Bedürfnisse des Marktes anzupassen und es mittelfristig an einen passenden Investor abzutreten. Seit 2011 hatte der LEH-Filialist mehr als 29 Mio. Euro in seine Modernisierung investiert. Die Grupo Profand (Jahresumsatz 2017: 168 Mio. Euro) mit Sitz in Vigo fischt mit 30 eigenen Schiffen in den weltweit wichtigsten Fanggründen. In acht Fabriken auf vier Kontinenten arbeiten über 2.300 Menschen für das Familienunternehmen. Zu den Profand-Kunden gehörte schon Mercadona. Von der Übernahme Caladeros verspricht sich Hauptgesellschafter Enrique García eine Stärkung des Segments wertgesteigerter Produkte.22.10.2019
Niederlande: LEH verwendet Blockchain für Tilapia-Rückverfolgung
Dank der Blockchain-Technologie können Kunden der holländischen Supermarktkette Jumbo jetzt für die dort angebotenen Tilapia-Produkte die komplette Produktions- und Handelskette einsehen, meldet das Portal Distrifood. Denn Produzent Regal Springs hat in Zusammenarbeit mit der Software-Schmiede SIM Supply Chain mit Hilfe der Blockchain entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt, die der Käufer des Produktes über einen QR-Code abrufen kann. Im konkreten Falle des Tilapias erfährt er, dass der Fisch in Indonesien gezüchtet und zu TK-Filets verarbeitet und verpackt wurde, bevor er in den Hafen Rotterdam verschifft wurde. Anschließend werden die TK-Filets bei dem Importeur Seafood Connection in Urk gelagert, bevor die Tiefkühlbeutel an Jumbo ausgeliefert werden. Die bei Jumbo ebenfalls angebotenen frisch verpackten Tilapia-Filets werden bei dem Fischproduzenten Mayonna in Spakenburg aufgetaut und verarbeitet. Ziel des Blockchain-Pilotprojektes sei es, mehr Transparenz zu schaffen und weitere Verbesserungen in den Bereichen Biodiversität, Menschenrechte und Tierschutz zu erreichen, teilte Jumbo mit.22.10.2019
Kanada: "Trudeau wird seine Meinung zur Lachszucht ändern"
Alf-Helge Aarskog, Geschäftsführer des weltgrößten Lachszüchters Mowi, äußerte sich zuversichtlich, dass der Wahlsieg des kanadischen Premiers Justin Trudeau keine negativen Auswirkungen auf die marine Lachszucht in Kanada haben werde, schreibt IntraFish. Trudeau hatte angekündigt, im Falle eines Sieges die Meereslachszucht in der Provinz British Columbia bis 2025 abzuschaffen. Aarskog verwies darauf, dass Trudeau in einer Minderheitsregierung auf Partner angewiesen sei, was ein Verbot weniger wahrscheinlich mache, und ergänzte: "Ich bin sicher, er wird erkennen, dass die Zucht in Netzgehegen recht gut für die Umwelt ist. Wenn die Welt etwas braucht, dann nicht noch mehr rotes Fleisch, sondern mehr Fisch und Gemüse."21.10.2019
Rückruf: Pangasius potentiell mit Reinigungsmitteln belastet
Mehrere Supermarktketten haben in der vergangenen Woche vorsorglich deutschlandweit einige Pangasiusfiletprodukte zurückgerufen. Bereits am Dienstag letzter Woche teilten Rewe und Penny mit, dass TK-Pangasiusfilets mit Rückständen des in Reinigungsmitteln enthaltenen Desinfektionsmittels Benzalkoniumchlorid belastet sein könnten. Dabei handele es sich um einen Gefahrstoff, der ätzend, reizend und umweltschädigend wirke. Betroffen seien alle Penny-Produkte "Berida Pangasiusfilet 475g, gefroren" (MHD März 2021, EAN-Nr.: 24 79 70 16) sowie alle Produkte "Rewe Beste Wahl Pangasiusfilet 475g, gefroren" (MHD März 2012, EAN-Nr.: 438 88 44 04 68 01). Unter der Fabriknummer "DL 22" läuft der vietnamesische Produzent Ben Tre Aquaproduct Import and Export Joint Stock Company (Aquatex Bentre).21.10.2019
Island: Brim übernimmt zwei Kabeljau-Produzenten
Islands führender Fischproduzent Brim, ehemals HB Grandi, will zwei Produzenten für Kabeljau, Fiskvinnslan Kambur und Grabrok, beide in Hafnarfjordur, kaufen, meldet IntraFish. Kambur verarbeitet im Jahr rund 2.000 t Kabeljau aus Langleinenfischerei. Den Kaufpreis von 2,3 Mrd. ISK, etwa 16,5 Mio. Euro, zahle Brim mit Unternehmensanteilen. Für das Fangunternehmen Grabrok, das eine Quote von 850 t Kabeljau ebenfalls aus Langleinenfischerei halte, zahle Brim 772 Mio. ISK, rund 5,5 Mio. Euro. Noch müssten der Brim-Vorstand sowie Islands Wettbewerbsbehörde der Übernahme zustimmen, da mit der Fusion Brims Quote für Langleinenkabeljau die staatlich zugelassene Höchstmenge überschreite.21.10.2019
Russland profitiert vom Handelskrieg gegen die EU
In dem seit fünf Jahren andauernden Handelskrieg zwischen Russland und der Europäischen Union zieht die EU offenbar den Kürzeren. Dafür sprechen neue Erkenntnisse der holländischen Rabobank, schreibt IntraFish. Seit August 2014 verbietet Russland die Einfuhr insbesondere frischer Lebensmittel in die EU, nachdem die Gemeinschaft Russland für seine Rolle im Konflikt um die Ostukraine mit Wirtschaftssanktionen abgestraft hatte. Statistiken offenbaren jedoch, dass Russlands Exporte in die EU im vergangenen Jahr nur um 12% auf 783,9 Mio. Euro zurückgegangen sind, während Norwegen und der EU durch den Wegfall von Lachsexporten nach Russland alleine 2019 ein Geschäft im Wert von 1,5 Mrd. Euro entgangen sei. "Die Russen stehen hier gut da: sie investieren viel in die Modernisierung ihrer Fischerei und Aquakultur - und das ist das perfekte Modell dafür", meint Gorjan Nikolik, führender Seafood-Experte in der Rabo-Forschungsabteilung Lebensmittel und Agrarwirtschaft.18.10.2019
Kabeljau: Preise in Europa "historisch hoch"
Eine anhaltend hohe Nachfrage nach Kabeljau insbesondere aus Norwegen hat die Preise für den Weißfisch in "historische Höhen" getrieben. Das teilten Industrie-Vertreter auf der Fischmesse Conxemar im spanischen Vigo Anfang Oktober mit, schreiben die Undercurrent News. Trotz der von Jahr zu Jahr gestiegenen Preise für frischen Kabeljau würden spanische Kunden dem Produkt weiterhin die Treue halten, teilte der Verkaufsleiter des norwegischen Lieferanten Norfra, Frode Eliassen, mit. Ein spanischer Einkäufer nannte Details: "Die Preise für Filet sind in Europa auf 7,90 bis 8,00 Euro/kg gestiegen, für Kabeljau ausgenommen ohne Kopf zahlen asiatische Märkte 4,- Euro/kg." Das vertikal integrierte norwegische Fangunternehmen WOFCO (Worldwide Fishing Company) habe jüngst in ein grönländisches Unternehmen investiert und einen Langleinenfänger gekauft, um angesichts der hohen Preise selbst Kabeljau in der Region fischen zu können. Igor Chematinov, Projektmanager beim portugiesischen Oktopus- und Kabeljau-Importeur Soguima, teilte mit, dass pazifischer Kabeljau inzwischen 20% preiswerter sei als atlantischer Kabeljau - anders als in vergangenen Jahren. Doch die Portugiesen würden den Fisch weiterhin kaufen, denn: "In Portugal haben wir Fleisch, Fisch und - Kabeljau."17.10.2019
Barentssee: Mehr Kabeljau, Schellfisch und Rotbarsch
Das gemeinsame russisch-norwegische Fischereikomitee, das die Fischbestände in der Barentssee managed, hat für das Jahr 2020 eine Anhebung der Kabeljaufangquote um 13.000 t oder 1,8% auf dann 738.000 t (2019: 725.000 t) beschlossen, meldet das Portal IntraFish. Dabei werde die Quote zwischen Norwegen, Russland und einigen anderen Ländern nach demselben Schlüssel verteilt wie schon in vorangegangenen Jahren. Für Schellfisch kann die Gesamt-TAC 2020 auf 215.000 t steigen, ein Plus von 20% im Vergleich zur 2019er Quote von 172.000 t. Für den Capelin gilt aufgrund der schlechten Bestandssituation weiterhin ein Fangverbot, sprich eine Quote von Null. Für den Grönland-Heilbutt wurde die TAC unverändert bei 27.000 t belassen, beim Rotbarsch dürfen mit 55.860 t 2.060 t mehr gefangen werden als 2019 (+ 3,8 %). Vladimir Grigorjev, Generaldirektor des in Murmansk ansässigen Fangunternehmens Rybprominvest JSC, zeigte sich gegenüber IntraFish mit den neuen Zahlen "generell zufrieden".17.10.2019
China: "Modernste Shrimp-Verarbeitung der Welt"
Chinas größter Shrimp-Verarbeiter, Zhanjiang Guolian Aquatic Products, hat im Süden Chinas einen Betrieb eröffnet, den Geschäftsführer Li Zhong als den "am höchsten automatisierten der Welt" bezeichnet. In der Fabrik in Zhanjiang (Provinz Guangdong) können täglich bis zu 100 t Rohware verarbeitet werden, darunter Shrimps aus chinesischer Zucht, aber auch Importware aus Südostasien, Indien, dem Mittleren Osten, Südamerika und Kanada. Die Produktion sei zu 70% automatisiert, zum Teil auch die maschinelle Schälung von Shrimps. Beliefert werden aus Zhanjiang LEH-Filialisten in China wie die Yonghui Superstores, Hema, eine Tochter der Alibaba-Gruppe, sowie Foodservice-Unternehmen.16.10.2019
Ostseefischerei: Umweltschützer fordern Fangstopp für Hering und Dorsch
Während Fischereiverbände nach den angekündigten Quotenkürzungen für die Ostsee mit zahlreichen Betriebsaufgaben rechnen, äußern sich Umweltschützer "weitgehend enttäuscht", schreibt Greenpeace. So halte die Umweltorganisation WWF die Kürzung der Heringsfangmenge 2020 um 65% und die für den Dorsch um 60% für nicht hinreichend. Die wesentlichen Fischbestände in der Ostsee würden stärker befischt als wissenschaftlich empfohlen. Deshalb sei beim Hering ein Fangstopp notwendig und beim westlichen Dorsch fordert der WWF eine Kürzung der Quote um 68%. Für den Dorsch in der östlichen Ostsee verlangt die Meeresschutzorganisation Oceana sogar ein Fangverbot. Die Fischereiverbände sehen sich derweil schwer getroffen. Benjamin Schmöde, stellvertretender Landesvorsitzender des Fischereiverbands Schleswig-Holstein, befürchte, dass die neuen Quoten bis zu 20 Fischereibetriebe zum Aufgeben zwingen könnten. Der Landesverband der Kutter- und Küstenfischer Mecklenburg-Vorpommern schätzt, dass bereits 2020 zehn bis 15 Betriebe die Fischerei einstellen werden. Die verbliebenen Betriebe werden u.a. mit Maßnahmen der Diversifizierung um ihr wirtschaftliches Überleben kämpfen.- Nordseekrabben
- Crangon crangon
- Thünen-Institut
- Lara Kim ...
- Bremerhaven
- Institut fü...
- Mowi
- Mowi Scotland
- Schottland
- Lachszucht
- Lachslaus
- Seehase
- Putzerfisch
- Lippfisch
- Amazon
- USA
- Lieferdienst
- Frischedienst
- Schottland
- Schottischer Lachs
- Lachszucht
- Salmon Scotland
- Tavish Scott
- Wechsler Feinfisch
- Insolvenz
- Erftstadt
- Theo Jansen