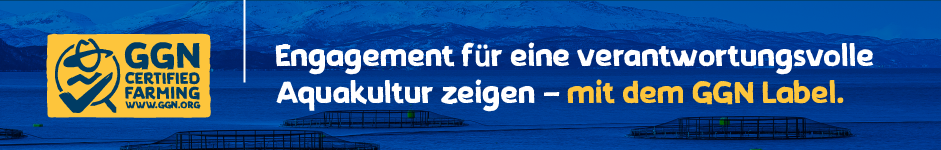03.07.2009
Cuxhaven: Neufischer weiht ersten Krabbenkutter ein
Zum Wochenbeginn wiesen 150 Kutterfischer in Bremerhaven auf ihre problematische Situation hin, am letzten Wochentag hat heute in Cuxhaven ein Neufischer seinen ersten eigenen Krabbenkutter eingeweiht. Der Cuxhavener Jens Tants will trotz EU-Bürokratie und holländischen Großkuttern mit dem Kutter ‚Saphir’ seine Familie ernähren, melden die Cuxhavener Nachrichten. „Heute brauche ich schon fast eine Sekretärin hier an Bord“, schimpft Jens Tants, der sich dennoch mit Mitte 30 seinen Kindheitstraum erfüllt. Der Sohn eines Fischers war auf dessen Rat hin zunächst Maurer geworden und hatte 15 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Vor vier Jahren begann er mit der Umschulung zum Kutterkapitän: erst wurde er Fischwirt, dann Kapitän für die Küstenfischerei und schließlich hat er seinen Meister gemacht. Gelernt hat Tants bei Eibe Cordts, dem früheren Kapitän der ‚Saphir’. Optimistisch kündigt Jens Tants an: „Ich lass’ mich nicht unterkriegen. Nicht von den Großkuttern aus Holland und auch nicht von den Bürokraten.“03.07.2009
Schweiz: Hans Raab verlegt Melander-Fischfarm nach Deutschland
Der deutsche Unternehmer Hans Raab verlegt seine umstrittene Melander-Fischfarm vom schweizerischen Oberriet nach Saarbrücken, schreibt die Schweizer Sonntagszeitung unter Berufung auf den Züchter. Raab hatte für die Tötung seiner Melander, einer Kreuzung verschiedener afrikanischer Welsarten, eine in der Schweiz verbotene Tötungsmethode eingesetzt, die jedoch in Deutschland und der EU erlaubt sei. Raalb ließ die in 27 Grad warmem Wasser gehaltenen Fische auf zehn Grad herunterkühlen. Dadurch seien sie, sagte Raab, zu 80 Prozent betäubt. Anschließend werden die Tiere in einer sich langsam drehenden, mit Eisscherben gefüllten Trommel entschleimt und schließlich maschinell getötet. Anfang April hatte der St. Galler Kantonstierarzt Raab eine Frist bis Mitte Mai eingeräumt. Solange durfte er die Fische in Oberriet auf die beschriebene Weise töten. Die Aufzucht junger Fische hatte Hans Raab schon Anfang April eingestellt. Auf die Forderung Raabs nach einer Ausnahmegenehmigung war die St. Galler Regierung nicht eingegangen. Der mit der Putzmittel-Linie „Ha-Ra“ reich gewordene Industrielle hatte in die Fischfarm rund 35 Mio. € investiert. Im April ließ er über seinen Anwalt verkünden, dass er vom Kanton Schadensersatz fordern wolle.03.07.2009
Größte Fischräucherei Österreichs eröffnet
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
29.06.2009
Dänemark: Nordsee-Hering erhält MSC-Zertifizierung
Nach einer Verfahrensdauer von nur zehn Monaten hat die Dänische Vereinigung der Schwarmfisch-Produzenten (DPPO) für ihre Nordseefischerei auf Hering die Zertifizierung durch den Marine Stewardship Council (MSC) erhalten. Das Verfahren erfolgte nach der neuen, seit Ende vergangenen Jahres verwendeten Fischerei-Bewertungs-Methodologie (FAM) des MSC, die die Bewertungsdauer verkürzen soll. Durchführende Organisation war der unabhängige Zertifizierer Det Norske Veritas (DNV), der die Überprüfung von Fischereien in sein Portolio aufgenommen hat. Dem Fischereiverband DPPO gehören acht Mitglieder an, die in der Nordsee zwischen Großbritannien, Dänemark und Norwegen mit Ringwaden und Schleppnetzen den herbstlaichenden Hering fischen. 2008 besaß die Fischerei eine Quote von 26.195 t. Derzeit unterziehen sich die DPPO-Schiffe auch einer Zertifizierung für ihre Fischerei auf atlanto-skandischen Hering und nordostatlantische Makrele. Nathalie Steins, MSC-Sprecherin für Nordeuropa, hob hervor, dass nun „sämtlicher Nordsee-Hering auf dem holländischen Markt das MSC-Logo tragen dürfe.“29.06.2009
Spanien: Qualitätsmarke für baskischen Bonito
Echter Bonito, von baskischen Fischern gefangen und in Häfen der spanischen Provinz angelandet, darf demnächst mit der Qualitätsmarke „Eusko Label“ gekennzeichnet werden. Mit dieser Qualitätsmarke wollen die Fischer des Baskenlands ihr Produkt vor anderen Marken auszeichnen und ihre Marktposition gegenüber preiswerteren Importprodukten stärken. Die letzte Saison sei mit einer Fangmenge von 1.883 t Bonito und 1.056 t Thun die „schlechteste“ seit Jahren gewesen, erklärt Miren Garmendia, Sekretärin der Vereinigung der baskischen Provinz Guipuzcoa - deshalb hoffen die Fischer nicht nur auf bessere Fänge, sondern auch auf bessere Preise im Großhandel. Um das Label tragen zu dürfen, müssen die Boniten einzeln traditionell gefangen und in einem baskischen Hafen angelandet worden sein. Das unverletzliche Sicherheitsetikett am Schwanz des Fisches gibt Auskunft über Tag und Hafen der Anlandung, Spezies, Kontroll-Nummer des Fangschiffs und informiert über das ‚Eusko Label’. Schon Ende vergangenen Jahres hatten baskische Hersteller von Thunfischkonserven eine regionale Marke ins Leben gerufen.29.06.2009
Mexiko: Neue preiswerte Alternative zu Fischmehl entwickelt
Wissenschaftler des mexikanischen Lebensmittel-Forschungs- und Entwicklungszentrums (CIAD) in Mazatlan (Bundesstaat Sinaloa) haben ein Futter für die Aquakultur entwickelt, das als Basis eine Mischung von Schlachtabfällen mariner und terrestrischer Tiere besitzt und klassisches, teureres Fischmehl ersetzen könnte. Das schreibt der mexikanische El Reportero de la Comunidad. Die Forscher haben dabei alternative Proteinquellen eingesetzt, die von Garnelen und Thunfisch sowie von Schwein und Geflügel stammen, sagt Mitarbeiterin Dr. Crisantema Hernandez Gonzalez. Angesichts der hohen Weltmarktpreise für Fischmehl suchte das Team neue Futtermittel für die einheimischen Zuchtarten, insbesondere Tilapia und Shrimp. Dr. Hernandez Gonzalez beschäftigt sich seit 1995 mit der Suche nach preiswerterem Futterrohmaterial aus den Schlachthäusern für Warmblüter sowie der Fisch- und Krustazeen-Verarbeitung. Gerade Abfallprodukte vom Schwein hätten hohe Akzeptanz bei den Zuchttieren gefunden, die wie gewünscht gewachsen seien und an Gewicht zugenommen hätten - und das mit geringeren Kosten. Jetzt wollen die Forscher die Akzeptanz des neuen Fischfutters bei Sackbrasse, Offiziersbarsch (Cobia) sowie Narrow-headed puffer (Sphoeroides angusticeps), einer Kugelfischart testen.29.06.2009
Island: Grandi will Kabeljauzucht fortsetzen
Grandi, Islands größtes Fischereiunternehmen, will seine experimentelle Kabeljauzucht an der Ostküste Islands trotz derzeit niedriger Marktpreise fortsetzen, meldet das norwegische Portal IntraFish. Momentan würden Daten zu Futter und Wachstumsrate gesammelt, teilte HB Grandi-Geschäftsführer Eggert Gudmundsson mit. „Wir gehen davon aus, dass sich der Markt in drei bis vier Jahren wieder erholt hat und dann können wir voll in die Produktion von bis zu 2.000 t einsteigen“, kündigte er an. Seine Lachsfarm habe Grandi inzwischen jedoch geschlossen. „Wir glauben nicht, dass Lachs hier gewinnbringend produziert werden kann. Da es auf Island kälter als in Chile oder Norwegen ist, ist der Wettbewerb erschwert.“29.06.2009
Gesellschaft für Landwirtschaft und Fischerei: Neue Geschäftsführerin
Prof. Dr. Olaf Mietz ist nicht mehr Geschäftsführer der Gesellschaft für Landwirtschaft und Fischerei in Brandenburg mbH, Seddiner See. Neue Geschäftsführerin ist Simone Mietz, Nuthetal (* 1962). Die Gesellschaft bewirtschaftet das älteste Bauerngehöft in Seddin, einen schilfgedeckten Lehmfachwerkbau an der Seddiner Hauptstraße. 2006 hatte das benachbarte Institut für angewandte Gewässerökologie das Anwesen in dem Ort knapp 50 km südwestlich von Berlin erworben. Der renovierte Schilfhof werde zu einer Begegnungsstätte mit Museum ausgebaut, meldete zu Beginn dieses Jahres die Märkische Allgemeine. So sei angedacht, in der Scheune aus Heidekraut-Stampflehm Produkte aus der eigenen Landwirtschaft und Fischerei, darunter auch frischen Fisch anzubieten. Der Wirt des nahen Restaurants „Truhe“, Oliver Muschke, sei gewonnen worden, dort im Sommerhalbjahr zunächst an den Wochenenden ein Restaurant zu betreiben, in dem traditionelle lokale und regionale Gerichte serviert werden.26.06.2009
Deutscher Fischereitag: Größter Kutter-Aufmarsch geplant
Zum diesjährigen Deutschen Fischereitag in Bremerhaven werden am kommenden Dienstag bis zu 170 Kutter im Fischereihafen der Seestadt erwartet - „der größte Kutter-Aufmarsch der letzten 60 Jahre“. Das kündigt Dr. Peter Breckling an, Geschäftsführer des Verbandes der deutschen Kutter- und Küstenfischerei. Denn die Stimmung der Fischer sei derzeit gereizt. „In der Kritik steht besonders die Brüsseler Fischereipolitik, die zu wenig auf die Belange der kleinen Familienbetriebe Rücksicht nimmt“, meint Dr. Breckling. Obgleich die Kutterfischer seit Jahren nachhaltig und umweltverträglich arbeiteten, stehe jetzt eine ganze Reihe neuer Regelungen an, die die Fischer „als bürokratische Exzesse und völlig überzogene Überwachung“ ansehen. So sollen die Krabbenfischer mit vier verschiedenen elektronischen Systemen per Satellit überwacht werden, ohne dass dadurch Verstöße aufgedeckt werden könnten. Neben den Fangquoten sollen kW-Tage - errechnet aus dem Produkt von Motorleistung und Tagen auf See - die Fischerei weiter einschränken. Neue Regelungen im Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften seien auf den Küstenkuttern teilweise nicht umsetzbar. Andere Nutzer auf See reduzieren die Fangebiete der Fischer zunehmend. Am Dienstag, den 30. Juni um 17:00 Uhr werden Kapitäne und Besatzungen ihre Forderungen in der Fischauktionshalle am Bremerhavener Islandkai vortragen.26.06.2009