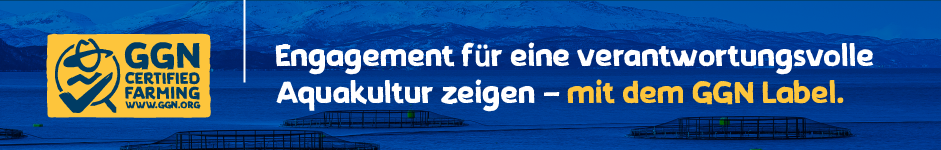26.06.2009
Niederlande: Fischpreise im ersten Quartal 20 Prozent gesunken
Der Durchschnittspreis für Frischfisch in den niederländischen Auktionen lag im ersten Quartal dieses Jahres rund 20% niedriger als im Vorjahreszeitraum. Das schreiben die Visserij Nieuws unter Berufung auf aktuelle Zahlen der niederländischen Dachorganisation United Fish Auctions (UFA). Der Preis für große Seezungen habe sich sogar nahezu halbiert, zitiert die Zeitung den Geschäftsführer Johan van Nieuwenhuijzen. Rückgänge seien jedoch bei allen Arten spürbar. Ursache ist die aktuelle Wirtschaftskrise, unter der auch Europas Caterer und Gastronomen, wichtige Abnehmer des Frischfischs, leiden.26.06.2009
Ecuador: Shrimp-Umsätze brechen um fast ein Drittel ein
Ecuador hat in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 18% weniger Shrimps exportiert als im Zeitraum Januar bis Mai 2008, meldet Fish Information & Services (FIS). Statt 15.481 t wurden nur noch 12.576 t ausgeführt, teilt die Nationale Handelskammer für Fischerei (CNP) mit. Die Erlöse sind sogar um 29% zurückgegangen und beliefen sich nur noch auf 38,6 Mio. € (1-5/2008: 55,1 Mio. €). Ursache seien die internationale Finanzkrise, die zu Überangebot und Preisrückgang führe. So sank der Shrimp-Preis nach Angaben der CNP von 3,94 €/kg im August 2008 auf derzeit 3.06 €/kg.25.06.2009
Griechenlands Züchter setzen auf den Adlerfisch
Große griechische Züchter von Dorade und Wolfsbarsch beginnen mit der Produktion von Adlerfisch, einem erfolgversprechenden Newcomer der mediterranen Aquakultur. Nireus beispielsweise will in diesem Jahr 300 t Adlerfisch produzieren - insgesamt werden im Mittelmeerraum 2009 voraussichtlich etwa 3.000 bis 4.000 t vom Argyrosomus regius erzeugt, schreibt das norwegische Portal IntraFish. Als zentralen Pluspunkt im Vergleich zu Dorade und Wolfsbarsch zeichnet den Adlerfisch ein schnelleres Wachstum aus. „Im Durchschnitt erreicht er in zwölf Monaten ein Gewicht von 900g, 1.700g in 18 Monaten und 2.500g in 24 Monaten. Zum Vergleich: eine Dorade wächst in 12 Monaten auf 220g ab, 400g in 18 Monaten und 600g in 24 Monaten“, sagt Maria Kotsovou, Marketingdirektorin bei Nireus. Aufgrund seiner Größe eigne sich der Adlerfisch besser zum Filetieren und Steaken und verspricht derzeit, angesichts der noch niedrigen Produktionsmenge, bessere Margen. So nennt der von der Föderation Europäischer Aquakultur-Produzenten (FEAP) erstellte Preisbericht 2008 für den Adlerfisch einen Durchschnittspreis von 5,09 €/kg - er kostete damit soviel wie Wolfsbarsch (5,12 €/kg) und war ein Drittel teurer als Dorade (3,69 €/kg). Da die Zucht des Fisches jener von Bream und Bass ähnelt, können die Farmer Technologie und Wissen größtenteils übertragen. Pioniere bei der Adlerfisch-Zucht waren Spanien, Italien und Frankreich. Nach Angaben der FEAP produzierte Spanien 2008 insgesamt 1.620 t, Italien 350 t und Frankreich 265 t. Die Erzeugermenge ist innerhalb von nur sechs Jahren um den Faktor 35 gestiegen: von 103 t (2003) auf inzwischen rund 3.500 t (2009). Wichtigste Exportmärkte für den Adlerfisch sind derzeit Italien, Großbritannien und die Niederlande, gefolgt von Spanien.25.06.2009
Störkaviar: Zwyer Caviar handelt Zuchtkaviar aus Uruguay
Das junge Schweizer Handelsunternehmen Zwyer Caviar importiert Störkaviar, der in Uruguay gezüchtet wird. Im September 2007 haben die Geschwister Alexander, Simone und Roger Zwyer in Appenzell ein Unternehmen gegründet, das Oscietra-Kaviar handelt, der von dem südamerikanischen Partner Esturiones del Rio Negro stammt. Alexander Zwyer wisse um die „Grauzone“ des Geschäfts mit Störkaviar und setze deshalb „auf vollumfängliche Transparenz“, schreibt die Schweizer Handelszeitung. Zwyer: „Wir sind bestrebt, uns nachhachhaltig im globalen Fine-Food-Markt zu entwickeln und zu etablieren. Unsere Philosophie basiert auf den sozialen und ökologischen Werten der Gesellschaft.“ Die Störe wachsen in einem Naturreservat, fernab der Zivilisation. Dort leben sie rund zehn Jahre oder länger in einem Flusssystem in Frischwasser und werden bis zu vier Mal täglich gefüttert. Der südamerikanische Kaviar ist zurückhaltend mit Flor de Sal aus Portugal gesalzen. Nach der Kaviarentnahme wird der ganze Fisch in Uruguay weiterverarbeitet. Zwyer liefert den Kaviar zum einen an Spitzenköche, außerdem wird er in einem Online-Shop verkauft, aktuell für 768,- CHF (508,- €) je 125g-Dose. In der vergangenen Woche hat Zwyer Caviar in Berlin eine deutsche Gesellschaft gegründet.25.06.2009
Großbritannien: Einzelhändler sponsored MSC-Verfahren
Die Wolfsbarsch-Fischerei im Bristol-Kanal lässt sich nach den Kriterien des Marine Stewardship Council (MSC) überprüfen, meldet der MSC. In der Bucht an der Westküste Großbritanniens, zwischen England (Cornwall) und Wales, wird der Loup de Mer seit mehr als 30 Jahren befischt. Antragstellerin für die Zertifizierung ist die North Devon Fishermen’s Association (NDFA), zu der eine Anzahl von Booten mit Längen unter und über zehn Metern gehören. Jährlich werden im Schnitt 40 Tonnen Wolfsbarsch angelandet, im vergangenen Jahr waren es sogar 59 Tonnen. John Butterwith, Chef der NDFA und Wolfsbarschfischer seit 1982, erklärte: „Die Vereinigung wird geschätzt für ihre Erhaltungsmaßnahmen: so werden einige Fanggebiete freiwillig für ein halbes Jahr geschlossen und generell Netze mit großen Maschenweiten verwendet, damit Jungfische entkommen können.“ Das Besondere an diesem Zertifizierungsverfahren: The Co-operative Group, die größte britische Konsumgenossenschaft (ca. 65.000 Beschäftigte), beteiligt sich an den Kosten der Zertifizierung. Schon im Sommer vergangenen Jahres hatte die Coop 200.000 Pfund (234.000 €) zur Verfügung gestellt, um kleinere britische Fischereien bei der MSC-Zertifizierung zu unterstützen. Das Förderpaket ist Teil einer im vergangenen Jahr formulierten „Verantwortlichen Fischeinkaufs-Politik“ der Coop, in deren Rahmen zunächst die Eigenmarken auf Rohware aus nachhaltiger Fischerei umgestellt werden.24.06.2009
Spanien: Fangverbot für Hammerhai und Fuchshai geplant
Spaniens Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft und Fischerei will die Zielfischerei auf Hammerhai (Sphyrnidae) und Fuchshai (Alopias vulpinus) und den Handel der beiden Arten verbieten, um diese als bedroht geltenden Spezies zu schützen, schreibt der Nachrichtendienst Fish Information & Services (FIS). Verboten werden soll die Fischerei mit jeder Art von Fanggerät und nicht nur die Langleinenfischerei. Spaniens Langleinenfischer fangen jährlich 45.000 t Haie, davon allerdings zu 95% die durch diese Zielfischerei nicht gefährdeten Blau- und Makohaie. Auch die spanischen Fangschiffseigner hätten ihre Bereitschaft erklärt, die beiden Arten zu schützen.24.06.2009
Nordsee-Kabeljau: ICES hält Quote von 40.300 Tonnen für möglich
Die Kabeljau-Bestände in der Nordsee haben sich inzwischen soweit erholt, dass der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) im kommenden Jahr eine Anhebung der Fangquote auf 40.300 t für vertretbar hält, meldet IntraFish. Die diesjährige TAC beläuft sich auf 28.800 t. „Wir sehen jetzt einen Aufwärtstrend“, erklärte ICES-Berater Hans Lassen. Die fischereiliche Sterblichkeit sei „unter Kontrolle“ und nehme ab. Der ICES werde seinen Vorschlag am kommenden Freitag der Europäischen Kommission präsentieren, die das nächste Treffen des Fischereirates im Dezember plane. Die Kommission folgt den Ratschlägen des ICES häufig nicht und hat in der Vergangenheit oft höhere Quoten festgesetzt als empfohlen. So hat das Kopenhagener Gremium von 2001 bis 2007 einen Fangstopp für Kabeljau in der Nordsee angeraten, die EU jedoch eine Quote zwischen 48.600 t und 20.000 t zugelassen. Erst 2008 folgte die Kommission dem ICES-Rat und setzte die TAC auf 22.000 t. Hans Lassen warnt jedoch: „Die Laicher-Biomasse ist noch nicht dort, wo wir sie gerne hätten.“ 1987 betrug die Fangquote für Nordsee-Kabeljau noch 175.000 t.24.06.2009
Schottland: Zertifizierung für Muscheln aus Seilkulturen angestrebt
Schottische Miesmuscheln aus Seilkulturen sind das erste kultivierte Seafood-Produkt, das in das Programm des Marine Stewardship Councils (MSC) aufgenommen wird, meldet das Portal IntraFish. Parallel bewirbt sich der antragstellende Produzent Scottish Shellfish auch um eine Zertifizierung durch Friend of the Sea (FoS). „Unsere Stammkundschaft hat in puncto Zertifizierung unterschiedliche Wünsche – deshalb bewerben wir uns um beide Standards“, erklärte Stephen Cameron, Geschäftsführer von Scottish Shellfish. Der MSC hatte im März erklärt, gefarmte Produkte ausnahmsweise dann zur Zertifizierung zuzulassen, wenn die Aquakultur auf Wildfängen aufbaut. Dies ist bei den an Seilen gezüchteten Muscheln der Fall, da die jungen Saatmuscheln zunächst gefischt werden. Scottish Shellfish liefert frische und weiterverarbeitete Muscheln an den LEH und an Großverbraucher, allerdings fast ausschließlich in Großbritannien und nur in geringerem Umfang ins Ausland. Die Scottish Shellfish Marketing Group repräsentiert mit ihren 19 angeschlossenen Muschel- und Austernfarmen an der schottischen Westküste und auf den Hebriden rund 70% der Produktion des Landes.23.06.2009
Somalia: Ex-Marinechef fordert Bundeswehr gegen Piratenfischer
Bundeswehrsoldaten sollen vor der Küste Somalias nicht nur Piraten bekämpfen, sondern auch illegale Fischer aus der EU. Das fordert der ehemalige Inspekteur der Marine, Admiral Lutz Feldt, im ARD-Magazin FAKT. Nach Informationen des Fernsehmagazins wird in der Europäischen Union bereits über eine Ausweitung der Anti-Piraten-Mission „Atalanta“ nachgedacht, um illegale Fischfangflotten ins Visier nehmen zu können. Das habe die ARD aus deutschen Sicherheitskreisen erfahren. Demnach will der Stab um den EU-Außenbeauftragten Javier Solana die Bekämpfung der illegalen Fischerei in die nächste Verlängerung des Mandats hineinnehmen. Nach Schätzung des Umweltprogramms der Vereinten Nationen entsteht Somalia durch die Piratenfischerei jährlich ein Schaden von 300 Millionen US-Dollar. Somalische Quellen sprechen von bis zu 220 illegalen Fangschiffen am Horn von Afrika, die weiterhin aktiv sind. Offiziell heißt es jedoch, die deutsche Marine sei zur Bekämpfung der Schwarzfischerei nicht in der Lage.23.06.2009