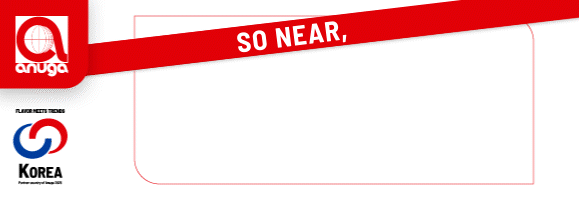08.05.2012
„Fisch mit Gütesiegel“ als Thema der Sendung Frontal21 im ZDF-Fernsehen
Am 8. Mai 2012 um 21.00 Uhr läuft in der ZDF-Sendung Frontal 21 ein Beitrag mit dem Titel „Fisch mit Gütesiegel“. Hierzu schreibt das ZDF:08.05.2012
Chile: Gewinnmargen vieler Lachszüchter unter Druck
Chiles Lachszüchter können für dieses Jahr offenbar keine großen Gewinne erwarten, prognostizieren zwei Finanzanalysten des Landes. Die Gewinnmargen großer börsennotierter Lachsproduzenten lägen inzwischen bei nur noch 0,23 Euro/kg, zitiert das Portal IntraFish den Analysten Ignacio Spencer von IM Trust Chile: "Ich befürchte, dass die Marge im laufenden Quartal bei kleineren Produzenten sogar eine Null sein könnte." Valerias Mutis, Analystin bei der Rabobank, erwartet bei den Gewinnspannen ebenfalls "etwas Rückgang". Dies sei zum Teil auf niedrige Preise, zum Teil auf eine "schwächere biologische Situation" in einigen Zuchtregionen zurückzuführen. Als Indikator hierfür werde das verstärkte Auftreten der Lachslaus Caligus gewertet, allerdings wiesen andere Kennziffern wie die Sterblichkeit unter den Fischen oder das durchschnittliche Erntegewicht derzeit allenfalls geringfügige negative Tendenzen auf.07.05.2012
Frosta: Leidet unter Wettbewerbsdruck
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
07.05.2012
Timmendorf: Gosch eröffnet 32. Filiale - mit einigen Neuerungen
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
04.05.2012
Neuseeland: Weltweit erstmals Fischerei auf Wittling MSC-zertifiziert
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
04.05.2012
Dänemark: Geldstrafe gegen Greenpeace wegen illegaler GPS-Sender
Ein Gericht im ostdänischen Helsingør hatte die Umweltorganisation Greenpeace im Januar in einem Prozess um die illegale Installation von GPS-Sendern auf Fischerbooten freigesprochen. Jetzt hat die nächsthöhere Instanz, bei der die klagenden Fischer gegen das Urteil Berufung eingelegt hatten, den Freispruch kassiert und Greenpeace zu einer Geldstrafe in Höhe von 25.000 DKK (3.361,- Euro) verurteilt, schreibt The Copenhagen Post. Außerdem muss der Greenpeace-Aktivist Sebastian Ostenfeldt Jensen 2.250,- DKK (302,- Euro) zahlen, weil er im Jahre 2010 die Routen-Kontrollgeräte auf den im Hafen von Gilleleje liegenden Fangschiffen angebracht hatte. Greenpeace will den jüngsten Richterspruch nicht akzeptieren und wird den Fall dem dänischen Obersten Gerichtshof vorlegen.03.05.2012
Nachhaltigkeit: ASC startet Akkreditierungsprozess für Pangasius
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
03.05.2012
Mexiko: Weltweit erste Fischerei auf Gelbflossen-Thun MSC-zertifiziert
Die Fischerei auf Gelbflossen-Thun (Thunnus albacares) und Echten Bonito (Katsuwonus pelamis) vor der mexikanischen Halbinsel Niederkalifornien (Baja California) ist vom Marine Stewardship Council (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifiziert worden. Die Thunfischerei in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Mexikos ist, was den Gelbflossen-Thun anbelangt, die erste weltweit, die das MSC-Zertifikat trägt. MSC-Klient ist Productos Pesqueros de Matancitas S.A. de C.V. (PPM), die mit zwei eigenen Fangschiffen den Thun mit 'pole and line' angeln. Die Fischerei operiert ganzjährig mit Schwerpunkt von Ende April bis Ende Dezember. 2009 wurden 379 Tonnen angelandet, die in der PPM-Fabrik in Puerto Adolfo Lopez Mateos, bekannt auch als Matancitas, zu Konserven verarbeitet und bislang in Mexiko vermarktet wurden. Durch die MSC-Zertifizierung verspricht sich Direktor Salvador Montes Zugang zu ausgewählten Märkten, die Produkte aus nachhaltiger und gut gemanagter Fischerei nachfragen.02.05.2012
Iglo: 2,2 Milliarden Fischstäbchen im Jahr
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
02.05.2012
Alaska: Wildlachs behält MSC-Zertifizierung unter neuem Klienten
Eine Fischerei-Organisation im US-amerikanischen Seattle will die MSC-Zertifizierung für die Alaska Wildlachs-Fischerei weiterführen. Das teilt der Geschäftsführer der Eignervereinigung der Ringwadenfänger (Purse Seine Vessel Owners Assocation - PSVOA), Bob Kehoe, mit. Im Januar hatte der bisherige MSC-Partner, die Alaska Fisheries Development Foundation, ihren Rückzug aus dem MSC-Programm angekündigt. Daher läuft die gegenwärtige Zertifizierung für Alaska Wildlachs im Oktober dieses Jahres aus. Jetzt wird die PSVOA, in der Fangschiffseigner der US-Westküste und aus Alaska zusammengeschlossen sind, als neuer MSC-Partner agieren. "Wir wurden von einigen Lachsverarbeitern angesprochen, die das MSC-Programm für Alaska Wildlachs aufgrecht erhalten wollen", erklärte Kehoe. Nicht zuletzt aufgrund dieses Nachhaltigkeitszertifikats erhielten die Fischer höhere Preise für ihre Fänge. Er sei optimistisch, dass es durch die Wiederaufnahme der Zertifizierung zu keinerlei Unterbrechungen hinsichtlich der Verfügbarkeit von MSC-Lachs kommen werde. "Der MSC ist die Marke für Nachhaltigkeit in vielen Lachsmärkten, insbesondere in Europa", betonte Bob Kehoe.- Norwegen
- Wahlen
- Jonas Gahr ...
- Pareto
- Henrik Longva ...
- Lachszucht
- Meeresaquakultur
- Lachssteuer
- Lachs
- Marine Stewardship ...
- MSC
- Hering
- Heringsprodukte
- Matjesfilets
- Heringssalat
- Bismarckhering
- Rollmops
- Nachhaltigkeit
- Atlanto-skandischer Hering
- Kathrin Runge
- Appel
- Hawesta
- Merl
- Certified Seafood ...
- CSI
- Responsible Fisheries ...
- Klaus Espersen