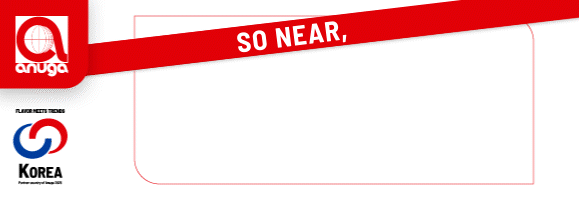12.06.2012
Dänemark: Trendwende bei Rahbekfisk
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
12.06.2012
Island: Google-Delegation trifft sich mit Fischereivertretern
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
12.06.2012
Dänemark: Sirena verdoppelt Gewinn
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
11.06.2012
Norwegen/Island: Soviel Kabeljau wie seit 40 Jahren nicht mehr
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
11.06.2012
England: Kleine Küstenfischerei startet Projekt zur Nachhaltigkeit
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
11.06.2012
Greenpeace protestiert mit Fischtrawler vor Brandenburger Tor
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
08.06.2012
Dänemark: Seezungen-Fischerei erhält MSC-Zertifikat
95 Prozent der dänischen Fischerei auf Seezunge sind gemäß den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifiziert worden. Antragsteller war die Dänische Produzentenorganisation der Fischer (DFPO), deren Schiffe ganzjährig in der zentralen östlichen Nordsee, wo es die höchste Konzentration an Seezungen (Solea solea) gibt, fischen. Mit zwei Fangmethoden, und zwar Grundschleppnetzen und Stellnetzen, fangen sie jährlich etwa 500 Tonnen. Der hochpreisige Plattfisch wird frisch, gekühlt oder gefroren insbesondere nach Holland, Deutschland, in die Schweiz sowie nach Spanien und Italien verkauft. Allerdings hat die Fischerei die Auflage erhalten, während der fünfjährigen Laufzeit des Zertifikats einige Verbesserungen einzuführen. Die neueste Zertifizierung ist Teil des ehrgeizigen dänischen Vorhabens, bis Ende dieses Jahres für sämtliche Fischereien des Landes eine MSC-Zertifizierung zu erhalten. Derzeit dürfen 72 Prozent der DFPO-Fischereien das blau-weiße MSC-Label führen.08.06.2012
Metro Cash & Carry: Vietnam-Woche in Deutschland
Eine "Vietnam-Woche" hat Metro Cash & Carry Anfang Juni an seinen 117 Standorten in Deutschland durchgeführt, schreiben die Thanh Nien News. An der Eröffnungsveranstaltung am 31. Mai in Berlin-Friedrichshain nahmen neben hochrangigen Mitarbeitern von Metro C&C, darunter Geschäftsführer Frans Muller, Ministerialbeamte aus Vietnam, Vertreter der vietnamesischen Botschaft und Berliner Politiker teil. Die Metro bietet zahlreiche Produkte aus Vietnam an, darunter frischer und gefrorener Pangasius, Black Tiger-Garnelen und Hummer. Fisch und Seafood werden über eine Plattform in Can Tho im Mekong Delta importiert. Im Rahmen der Aktion werden an die 1,4 Mio. Metro-Kunden Werbematerialien verteilt. Metro C&C ist seit zehn Jahren auch in Vietnam vertreten, wo sie 2002 ihren ersten Großmarkt in der Hauptstadt Ho Chi Minh-Stadt eröffnete und inzwischen landesweit 17 Standorte (Stand: 31.03.2012) unterhält. Wichtig für ihre deutschen Kunden ist ein striktes System der Rückverfolgbarkeit sowie der Qualitäts-, Hygiene- und Sicherheitskontrolle. Seit 2002 habe die Metro 20.000 vietnamesische Farmer und Fischer geschult, um ihre Erträge und die Produktqualität zu erhöhen.08.06.2012
Polar Seafood: 2011 endete mit sieben Prozent Gewinn
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
07.06.2012
Ostsee-Quoten: Mehr Hering und Sprotte, stabile Dorschbestände
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
- Norwegen
- Wahlen
- Jonas Gahr ...
- Pareto
- Henrik Longva ...
- Lachszucht
- Meeresaquakultur
- Lachssteuer
- Lachs
- Marine Stewardship ...
- MSC
- Hering
- Heringsprodukte
- Matjesfilets
- Heringssalat
- Bismarckhering
- Rollmops
- Nachhaltigkeit
- Atlanto-skandischer Hering
- Kathrin Runge
- Appel
- Hawesta
- Merl
- Certified Seafood ...
- CSI
- Responsible Fisheries ...
- Klaus Espersen