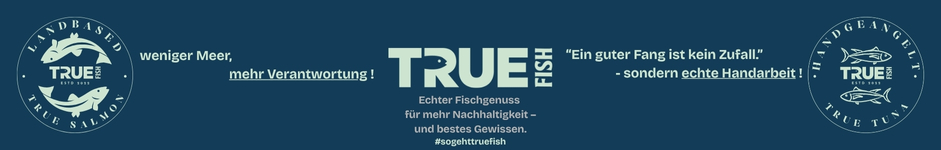28.11.2012
Belgien: Sodexo serviert MSC-Fisch im EU-Parlament
Sodexo hat als erster Foodservice-Lieferant in Belgien die Produktketten-Zertifizierung des Marine Stewardship Councils (MSC) erhalten. Zunächst wird der weltweit führende GV-Dienstleister den Kantinengästen im Europäischen Parlament in Brüssel, Patienten des Universitäts-Krankenhauses in Ghent, 200 Schulen, die über die Zentralküche der Gemeinde Anderlecht versorgt werden, sowie den Bewohnern des Alten- und Pflegeheims 'Home Les Tilleuls' (CPAS St-Gilles) MSC-zertifizierten Fisch servieren. Im vergangenen Jahr hatte Sodexo eine weltweit geltende Vereinbarung mit dem MSC unterschrieben, wonach das Foodservice-Unternehmen Fisch mit MSC-Label bewerben wolle. Nach Beratung durch die Umweltorganisation WWF startete die nachhaltige Fisch-Einkaufspolitik mit dem Streichen von 15 bedrohten Fischarten von den Speisekarten. Diese Auslistung setzte Sodexo bis August 2012 in allen 80 Ländern um, in denen der Dienstleister aktiv ist. Für rund 2.000 Standorte in Großbritannien und den Niederlanden besitzt Sodexo eine CoC-Zertifizierung, so dass beispielsweise MSC-zertifizierter Kabeljau, Scholle, Hoki und Alaska-Seelachs serviert werden. Sodexo liegt mit global 420.000 Beschäftigten (Jahresumsatz: 18,2 Mrd. Euro) unter den weltweit größten Arbeitgebern auf Rang 20. Täglich werden 75 Millionen Kunden bedient.28.11.2012
Kritik am MSC-Standard: Gewinnstreben gefährdet Glaubwürdigkeit
Der Nachhaltigkeitsstandard des Marine Stewardship Councils (MSC) droht im Falle einiger Fischereien auf Thun zu verwässern, um diese lukrativen Fischereien ins MSC-Programm zu bekommen und entsprechende Lizenz- und Logo-Nutzungsgebühren zu kassieren. Diese Befürchtung sollen hinter vorgehaltener Hand und anonym mehrere Experten geäußert haben, die im Auftrag der akkreditierten unabhängigen Zertifizierer in den Prüfungsteams mitarbeiten, schreibt das Portal Seafood Source. Die Bedenken betreffen insbesondere die Kontrollen von Anlandemengen in Relation zur Bestandssituation, das sogenannte System der 'harvest control rules'.28.11.2012
Schleswig-Holstein: Internet-Plattform zur Fischerei
Der Osten Schleswig-Holsteins besitzt seit Neuestem ein Internetportal zur Fischerei. Am Donnerstag, den 22. November, gaben Landwirtschafts- und Umweltminister Dr. Robert Habeck (Grüne) und Fehmarns Bürgermeister Otto-Uwe Schmiedt im Hafen Burgstaaken mit einem dreifachen Glockengeläut die Homepage www.fischerleben-sh.de frei, meldet 'Fehmarn 24'. Sie soll das Image der Fischerei stärken und sie ins Bewusstsein der Menschen rücken, erklärte der Minister. Das Portal präsentiere "die ganze Weite des Fisches und der Fischerei". Einzelne Rubriken informieren über Fischereihäfen, die Hochsee- und die Angelfischerei, über Fischarten und Fangtechniken oder den Beruf des Fischers. In der Rubrik "Fisch kaufen" werden Direktvermarkter, Fischgeschäfte und Märkte aufgeführt, bislang allerdings ganz überwiegend in der östlichen Hälfte des Bundeslandes. Jeder könne an der Seite mitwirken, sagt Beate Burow, die sich um die Einwerbung der Gelder für das Projekt kümmere. Finanziert wird das Portal im ersten Jahr mit knapp 17.000 Euro aus Mitteln des Europäischen Fischereifonds (EFF) und mit 33.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein.27.11.2012
UFT AG: Florian Hartung verlässt Geschäftsführung
Florian Hartung (* 1981) scheidet zum Jahresende aus der Geschäftsführung des Aquakultur-Unternehmens United Food Technologies AG (UFT AG) in Weinheim aus. Nach mehreren Jahren in der UFT wolle er jetzt "neue Herausforderungen" annehmen, teilte Hartung heute in einem Schreiben mit. Die Geschäftsführung des Herstellers von Aquakulturanlagen habe der AG-Vorstand seinem Vater Christoph Hartung (* 1942) übergeben. Die UFT AG ist Muttergesellschaft des Störzüchters und Kaviarproduzenten Aquaorbis (Jessen/Sachsen-Anhalt), der sich im Insolvenzverfahren befindet. Florian Hartung ist weiterhin Geschäftsführer der ebenfalls in Weinheim ansässigen Windfall Invest GmbH. Dabei handelt es sich um die im Sommer 2007 gegründete Vermögensverwaltungsgesellschaft insbesondere für die UFT. Der Begriff 'windfall profit' bezeichnet in den Wirtschaftswissenschaften Vermögenszuwächse, die nicht auf entsprechenden Leistungen der Gewinnbezieher beruhen, sondern durch plötzliche, außergewöhnliche Veränderungen der Marktsituation entstehen.27.11.2012
Russland: Ein exzellentes Jahr für die Fischerei
Russland hat seit Jahresbeginn insgesamt 3,6 Mio. t Fisch angelandet, meldet das Portal IntraFish. Wichtigster Fisch ist Alaska-Pollack mit 1,46 Mio. t (+48.000 t). Ein Plus gegenüber den Fangmengen im Jahre 2011 bedeuten auch die 441.000 t Lachs (+117.000 t), 361.300 t Kabeljau (+16.600 t), 73.700 t Flunder (+2.500 t), 38.600 t Krabben (+2.600 t), 26.600 t Grenadier (+6.900 t) und 55.300 t Grünling (+3.600 t). Eine Enttäuschung war allerdings die Fischerei auf den Pazifischen Hering, die nahezu ausfiel: 3.400 t waren dramatische 300.000 t weniger als im Jahre 2011.27.11.2012
Taiwan/Somalia: Fangschiffe dürfen Bewaffnete anheuern
Die Regierung von Taiwan bereitet die Änderung ihres Fischereirechts vor, damit Fangschiffe in Zukunft bewaffnete Sicherheitskräfte an Bord nehmen dürfen, teilte ein leitender Mitarbeiter der Fischereibehörde dem 'Focus Taiwan' mit. Hintergrund seien Vorfälle in den Gewässern vor Somalia, bei denen taiwanesische Fischerboote in die Hände von Piraten gefallen waren. Schon im vergangenen Jahr hatte die Taiwanesische Thunfisch-Vereinigung mit der Regierung von Sri Lanka ein Abkommen unterzeichnet. Danach wird jede Fangschiff von drei Soldaten aus Sri Lanka begleitet, die das Feuer eröffnen, sobald sich Piraten in Schnellbooten nähern.27.11.2012
Europäische Union: Erstmals Länderliste zur illegalen Fischerei
Die Europäische Union hat erstmals eine Liste mit Staaten veröffentlicht, die aus Sicht der EU-Kommission bei der Bekämpfung der illegalen, ungemeldeten und unregulierten Fischerei (IUU-Fischerei) nicht kooperieren. Diese Liste umfasst derzeit die acht Länder Belize, Fidschi, Guinea, Kambodscha, Panama, Sri Lanka, Togo und Vanuatu. Für den deutschen Markt ist hier Sri Lanka ein wichtiges Lieferland für hochpreisigen exotischen Frischfisch: 2011 kamen von dort 1.497 Tonnen Seefisch im Wert von 16,3 Mio. Euro zu einem Durchschnittspreis von 10,93 Euro/kg.26.11.2012
Pazifischer Heilbutt: Schwache Nachfrage trotz Preisrückgang
Pazifischer Heilbutt aus US-amerikanischer Fischerei ist trotz gewissen Preisrückgangs offenbar noch immer zu teuer, um die Nachfrage anzukurbeln. Obgleich der Fisch beim Großhändler Westward Seafoods, einem Tochterunternehmen von Maruha Nichiro, derzeit für 12,- bis 13,- USD/Pound (20,62 Euro bis 22,33 Euro/kg) gehandelt werde und damit mindestens 2,- USD/Pound (3,44 Euro/kg) unter dem Preis 2011, koste er noch immer 50 Prozent mehr als 2009, erklärt Verkaufsleiterin Shu Suzuki. Gerüchten zufolge liegen noch immer erhebliche Mengen aus der Vorjahressaison in den Tiefkühlhäusern. "Die einzigen, die mit Pazifischem Heilbutt Geld verdienen, sind die Fischer", meint Rob Reierson, Geschäftsführer von Tradex Foods. Die Fangmengen beim Pazifischen Heilbutt sind seit dem Peak von 33.505 Tonnen im Jahre 2004 zurückgegangen über 15.981 Tonnen im letzten Jahr auf nur noch 12.984 Tonnen im Jahre 2012. Die Folge: kein Fisch im US-Einzelhandel war in den 52 Wochen vor August 2012 teurer als Pazifischer Heilbutt mit durchschnittlich 32,88 Euro/kg. Mit gewissem Abstand folgten Wolfsbarsch und Dorade (30,55 Euro/kg), schon weit abgeschlagen auf Rang 3 Schwertfisch mit 19,38 Euro/kg. Der durchschnittliche Preis für Pazifischen Heilbutt ab Schiff hat sich seit 2009 mehr als verdoppelt und lag 2011 bei 11,37 Euro/kg (2009: 5,33 Euro/kg; 2005: 4,30 bis 5,15 Euro/kg).26.11.2012
Irland: Streit um geplante Megafarm für Biolachs
Die irische Behörde für Binnenfischerei hat in einem 16-seitigen Gutachten Bedenken geäußert, in der westirischen Galway-Bucht eine 15.000 Tonnen-Farm für Biolachs zu errichten, schreibt IntraFish. Zum einen verwies Inland Fisheries Ireland (IFI) auf eine jüngst publizierte Studie zu Lachsläusen aus Zuchten, die demnach in erheblichem Umfang für den Rückgang der Wildlachsbestände verantwortlich sein sollen. "Die mögliche Übertragung von Lachsläusen von den vorgeschlagenen Farmstandorten auf wilde Smolts ist nicht hinreichend wissenschaftlich untersucht", meint IFI. Außerdem schmälerte die Behörde die Trumpfkarte Schaffung von Arbeitsplätzen.26.11.2012