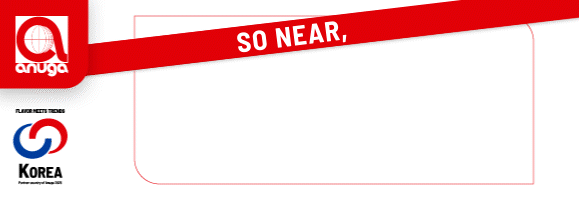18.10.2016
Bremerhaven: Staatsanwaltschaft ermittelt in Asbest-Fall bei der FBG
Beim Abriss der ehemaligen Nordsee-Verwaltung in der Bremerhavener Klußmannstraße sind rund 50 Mitarbeiter der Fischereihafen-Betriebsgesellschaft (FBG) teils über Monate einer Asbestbelastung ausgesetzt gewesen, meldete Radio Bremen. Dabei habe dem Unternehmen schon mehrere Monate vor Beginn der Abrissarbeiten ein Gutachten vorgelegen, das die Kontaminierung des Gebäudes mit Asbest und sogenannten künstlichen Mineralfasern (KMF) festgestellt hatte. Als die Bauarbeiten am 4. Januar 2016 begannen, sei jedoch von Gutachten und Schadstoffen keine Rede mehr gewesen.17.10.2016
Niederlande: Skretting verwendet Algenöl in Lachsfutter
Als "Durchbruch" bezeichnet der Futtermittelhersteller Skretting ein neues Algenöl mit einem bislang nicht erreichten Gehalt an Omega-3-Fettsäuren, schreibt Fish Information & Services (FIS). Das in Partnerschaft mit dem wissenschaftsbasierten Unternehmen Royal DSM und dem auf spezielle Chemikalien fokussierten Hersteller Evonik entwickelte Produkt MicroBalance® enthält die ungesättigten Fettsäuren EPA und DHA, die in der marinen Mikroalge beide natürlicherweise vorkommen. Da die Meeresalgen an Land kontrolliert produziert werden, besitze Skretting damit eine nachhaltige Omega-3-Quelle in definierbarer Menge. Derzeit würden Pilotversuche mit Lachs- und Forellenfutter für die Aquakultur durchgeführt.17.10.2016
Russland hebt Alaska-Seelachs-Quote an
Russland hat seine Fangquote für den Alaska-Seelachs für das kommende Jahr um 2,9 Prozent auf 1,891 Mio. t angehoben, meldet das Portal IntraFish. Der Pollack ist mengenmäßig der bei weitem wichtigste Fisch der russischen Fangflotte. So liegt die TAC für den Pazifischen Hering im kommenden Jahr bei 326.150 t, vom Pazifischen Kabeljau dürfen 121.600 t gefangen werden und bei der Flunder in Fernost sind es 76.460 t. Die Quote für Krebse liegt 2017 bei 7.350 t und damit 10,2 Prozent höher als in der laufenden Saison und bei Garnelen steigt die zulässige Fangmenge um 9,3 Prozent auf 14.900 t. Weitere TACs für Meeresfrüchte: die Königskrabben-Quote für die Barentssee liegt bei 8.510 t, für die Schneekrabbe bei 1.600 t und von den Tiefsee-Scallops dürfen 1.100 t gefischt werden. In der Ostsee erlaubt Russland den Fang von 29.500 t Hering, 42.600 t Sprotten und 6.100 t Dorsch. Für das laufenden Kalenderjahr meldet das Land bis zum 12. September eine Gesamtfangmenge von 3.823.200 t - ein Plus von 5,7 Prozent. Die Anlandungen beim Alaska-Seelachs liegen demnach mit 1,419 Mio. t gut 4,2 Prozent über dem Vorjahresergebnis.15.10.2016
Hamburg: Eimskip wechselt nach Bremerhaven
Der Hamburger Hafen verliert die isländische Reederei Eimskip als Kunden, meldet das Hamburger Abendblatt. Motiviert durch die Schließung des Buss Hansa Terminals auf Steinwerder verlässt Eimskip die Hansestadt und wird künftig am Eurogate-Terminal in Bremerhaven abgefertigt. Für Hamburg bedeutet dies einen durchaus spürbaren Mengenverlust: bislang kam wöchentlich ein Eimskip-Schiff, das insbesondere Tiefkühlfisch brachte und Container mit Gebrauchsgütern über den Nordatlantik mitnahm – insgesamt 52 Schiffsanläufe per anno mit einem Ladungsaufkommen von umgerechnet 22.000 Standardcontainern. „Nach 90 Jahren im regelmäßigen Liniendienst nach Hamburg bricht für Eimskip in Bremerhaven eine neue Ära an. Wir erwarten Synergien und neue kommerzielle Chancen“, sagte Jan Felix Großbruchhaus, seit drei Jahren Geschäftsführer von Eimskip Deutschland. Durch seine Nähe zur Fischindustrie sei Bremerhaven der ideale Standort.14.10.2016
Software: CSB-System ist "ERP-System des Jahres"
Die Branchensoftware der CSB-System AG hat die Auszeichnung "ERP-System des Jahres 2016" in der Kategorie "Food und Lebensmittel" erhalten, teilt das in Geilenkirchen ansässige IT-Unternehmen mit. Die elfköpfige Jury, ein unabhängiges Expertengremium des "Center for Enterprise Research" (CER) der Universität Potsdam, würdigte die Branchenspezialisierung, den Umfang sowie die Integrationsfähigkeit der CSB-Komplettlösung. "Mit ihren Lösungen übernimmt die CSB-System AG außerdem die Vorreiterrolle im Bereich Industrie 4.0 und zeigt, wie die digitale Zukunft der Nahrungsmittelverarbeitung aussieht", sagte der Vorsitzende der Jury, Prof. Dr.-Ing. Nobert Gronau, "gerade in den Bereichen industrieller Bildverarbeitung und Automatisierung wird deutlich, welche Vorteile sich durch die Smart Food Factory für die Unternehmen ergeben." Für seine industriellen Bildverarbeitungslösungen "CSB-Vision" hatte die CSB-System AG im Mai schon den Fleischerei Technik Award in der Kategorie Automatisierung erhalten. Vanessa Kröner, CSB-Vorstand für die Bereiche Finanzen, Vertrieb und Marketing, hob hervor, dass man als Branchenspezialist "vor allem Kosteneinsparungen und langfristige Produktivitätssteigerungen" im Blick habe.14.10.2016
Schottland: Prince Charles besucht Marine Harvest-Lachsfarm
Der britische Thronfolger Charles, Prince of Wales, hat Anfang Oktober eine schottische Farm des weltgrößten Lachszüchters Marine Harvest (MH) besucht, meldete am Donnerstag der Herald Scotland. In der Loch Leven-Lachsfarm ließ sich seine königliche Hoheit vor Ort über die dort zur Bekämpfung der Lachslaus eingesetzten Putzerfische informieren. Die Farm in Kinlochleven war 2015 die erste Lachsfarm in Großbritannien, die ein Zertifikat des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) erhalten hat. MH setzt seit 2012 Putzerfische ein, und zwar mit einer Erfolgsquote von 100 Prozent. Aktuell seien 12 Farmen mit den Tieren besetzt, im kommenden Jahr sollen es 22 sein.14.10.2016
Dänemark: 80.000 Regenbogenforellen nach Schiffskollision entkommen
Rund 80.000 Regenbogenforellen sind aus einer Meersfischzucht vor der dänischen Ostküste entkommen, nachdem der mit Holz beladene maltesische Frachter „Karmel“ die Farm am Montag aufgrund eines Navigationsfehlers gerammt hatte, schreibt der Maritime Herald. Das Schiff war auf dem Weg von Kaliningrad nach Kolding, als es die Gehege der Farm von Snaptun Fisk Export, die im Kleinen Belt - zwischen der Insel Fünen und dem jütländischen Festland - liegt, beschädigte. Die Forellen von jeweils 3 kg Gewicht sollten in 14 Tagen geschlachtet werden. Nach Angaben von Mitinhaber und Direktor Tim Petersen lag der Wert der rund 240 t Forellen bei 9 Mio. DKK, rund 1,2 Mio. Euro. Dr. Jon Svendsen von der Dänischen Technischen Universität und Søren Knabe von der Umweltorganisation Vandpleje Fyn befürchten negative Folgen für die Bestände der wilden Meerforelle. Knabe meint, dass der Zeitpunkt für den Vorfall nicht hätte schlechter sein können: „Die Meerforellen kommen zur Zeit nach Fünen, um hier zu laichen – und die Eier der Meerforelle gehören zur Lieblingsspeise der Regenbogenforelle.“ Entsprechend sind die Fischer und Angler in der Region aufgefordert, die Zuchtforellen zu fischen, um die Auswirkungen auf die Umwelt gering zu halten.14.10.2016
Niederlande: EU arbeitet an Zulassung von Insektenprotein im Fischfutter
Die EU-Kommission diskutiert die Zulassung von Insektenproteinen als Inhaltsstoff von Aquakultur-Futtermitteln, meldet der Feed Navigator. Anlässlich eines Besuchs beim holländischen Futterproduzenten Protix Biosystems, der Insekten einsetzt, skizzierte Xavier Prats Monné, Generaldirektor der EU-Generaldirektion Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (DG Santé), wieweit der gesetzgeberische Prozess inzwischen fortgeschritten sei. Die „Internationale Plattform für Insekten in Lebens- und Futtermitteln“ (IPIFF), ein Zusammenschluss von Insektenverarbeitern aus Holland, Frankreich und Deutschland, u.a. Protix, teilte mit, der Besuch habe den EU-Politikern einen Einblick in die Insektenverarbeitung vor Ort ermöglicht.13.10.2016
Chile: Cermaq erhält Zertifizierung „antibiotika-frei“ für drei Farmen
Der Lachszüchter Cermaq hat für drei seiner Lachszuchten in den Regionen Los Lagos und Magallanes Zertifikate darüber erhalten, dass die Fische in den Farm-Zentren keine Antibiotika erhalten, meldet IntraFish. Die drei Zuchten Chope, Calen 1 und Isla Garcia hatten sich freiwillig prüfen lassen und erhielten die Bestätigung von der chilenischen Fischerei- und Aquakultur-Behörde Sernapesca. „Wir haben im August mit dem Verfahren begonnen, das uns jetzt bestätigt, dass wir in puncto Nachhaltigkeit sowohl im Hinblick auf das Tierwohl als auch auf Umwelteinflüsse etwas unternommen haben“, kommentierte Francisco Miranda, Produktionsleiter bei Cermaq Chile.13.10.2016
Großbritannien: Aldi bietet Premium-Produkte zur „Seafood Week“
Aldi hat in ausgewählten Filialen in Großbritannien zur dortigen „Seafood Week“ verschiedene Premium-Produkte vorgestellt, meldet das Portal IntraFish. Nur für einen begrenzten Zeitraum – vom 7. bis zum 12. Oktober – gab es in den entsprechenden Märkten etwa „Specially Selected Black Tiger Prawns“ (für 3,75 GBP = 4,15 Euro) und ebenso „ausgewählte“ ofengeräucherte Regenbogenforelle (2,99 GBP = 3,31 Euro), außerdem Kabeljau im Bierteig (2,49 GBP = 2,75 Euro), geräucherten Schellfisch oder getoastetes Kabeljau-Sandwich - „Cod Rarebit“ (2,99 GBP = 3,31 Euro) sowie Bücklinge mit Butter (0,99 GBP = 1,09 Euro). Ebenfalls im Sondersortiment waren eine Muschelmahlzeit der „Seafood Company“ (0,75 GBP = 0,83 Euro) und Flusskrebsschwänze (2,79 GBP = 3,08 Euro). Parallel stellte Aldi auf seiner britischen Internetseite Fischrezepte ein und bot auf seinem Youtube-Kanal „The Taste Kitchen“ Tipps zur Fischzubereitung.- Landwirtschaft
- Aquakultur
- Niedersachsen
- Landjugend
- Aal-Hof Gö...
- Cloppenburg
- Wolfsbarsch
- Niehues
- Münster
- Geflossenschaft
- Ulrich Averberg
- Mikroalgen
- Stefan Feichtinger
- illegale Fischerei
- IUU-Fischerei
- Welthandelsorganisation
- WTO
- Abkommen
- Subventionen
- Ngozi Okonjo-Iweala
- Marine Stewardship ...
- Aquaculture Stewardship ...
- MSC
- ASC
- Check deinen ...
- Florian Zerbst
- Fischsommelier