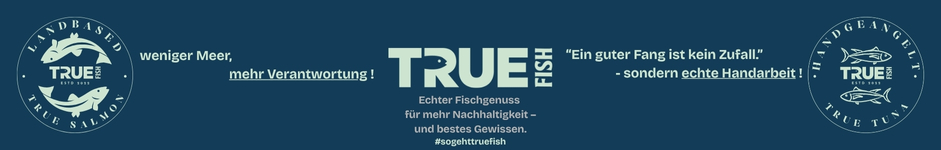13.11.2019
Bremerhaven: Nordsee fordert Sparprogramm für Standortzusage
Die Restaurantkette Nordsee will eine Zusage, dass sie ihre Hauptverwaltung nicht aus Bremerhaven abzieht, offenbar nur geben, wenn der Betriebsrat ein Sparprogramm umsetze und auf entscheidende Informations- und Beteiligungsrechte verzichte. Das schreibt die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG), Region Bremen-Weser-Elbe, in einer Pressemitteilung. Demnach sollen Interessenausgleich und Sozialplan noch in diesem Jahr verhandelt und beschlossen werden. Damit könnten bereits vor Weihnachten die ersten Kündigungen ausgesprochen werden. Der Betriebsrat teilte mit, sich auf diesen "Kompromiss, allein um den Schein zu wahren", nicht einlassen zu wollen. "Der Verbleib der Nordsee-Hauptverwaltung in Bremerhaven ist das wichtigste Anliegen des Betriebsrats", teilte Moritz Steinberger, Gewerkschaftssekretär der NGG, mit.12.11.2019
Argentinien: Gute Qualität bei Rotgarnelen zum Saisonstart
Argentiniens Fischer äußern sich nach dem Start der Fischerei auf die Argentinische Rotgarnele (Pleoticus muelleri) zufrieden mit Größe und Qualität der Garnelen, meldet Fish Information & Services (FIS). Größere Sortierungen dominierten die Fänge: die Größen würden in der Rangfolge L1 (10/20 Stück(kg), L2 (20/30 Stück/kg) und L3 (30/40 Stück/kg), gefischt. Die Rotgarnelen, die die Fabriken erhielten, wiesen eine gute Qualität auf bezüglich der Aspekte Farbe, exoskelettale Struktur und Schalenhärte. Auch die Größe der Garnelenvorkommen bezeichneten die Fischer als "gut".12.11.2019
Frosta verzichtet bis Ende 2020 komplett auf Plastik
Der Bremerhavener Tiefkühlkost-Hersteller Frosta will bis Ende kommenden Jahres komplett von Plastik- auf Papierbeutel umsteigen. "Unser Reinheitsgebot gilt bisher nur für alles in der Packung: ausschließlich natürliche Zutaten, keine Zusatzstoffe. Wir wollten eine ebenso reine, natürliche Lösung für die Verpackung selbst", teilt Frosta, Marktführer in einigen Bereichen des Tiefkühlmarktes, auf seiner Homepage mit. Mehr als drei Jahre lang habe ein Expertenteam in tausenden von Arbeitsstunden und 180 verschiedenen Belastungstests eine inzwischen patentierte Lösung gefunden: eine neue, innovative Papiermischung, die eine wirksame Barriere gegen Fett und Feuchtigkeit bilde und reißfest sei. Der Papierbeutel ist ungebleicht und das Papier aus nachhaltiger, FSC-zertifizierter Forstwirtschaft ist nur sparsam mit wasserbasierten Farben bedruckt. Damit können die Verpackungen im Altpapier entsorgt und problemlos recycelt werden. Dank der Innovation könnten rund 40 Millionen Plastikverpackungen pro Jahr eingespart werden. Allerdings würden die Produkte um etwa 5 Prozent teurer, sagt Unternehmenssprecherin Friederike Ahlers. Firmenchef Felix Ahlers gestand gegenüber der "Welt", dass er mit diesem Schritt ein Risiko eingehe. Doch: "Wir wollen gutes, echtes Essen anbieten. Aber wo soll das zukünftig herkommen, wenn wir mit Verpackungsmüll die Erde zerstören?", heißt es auf der Frosta-Homepage. Daniel Müsgens vom WWF lobte die neue Verpackung angesichts der Verwendung von Zellstoff als Fortschritt.12.11.2019
Norwegen: Vindheim neuer Geschäftsführer von Mowi
Alf-Helge Aarskog, seit zehn Jahren Geschäftsführer des weltgrößten Lachsproduzenten Mowi, ist von seinem Führungsposten zurückgetreten, meldet IntraFish. Im Rahmen einer unternehmensinternen Nachfolge übernimmt der bisherige CFO Ivan Vindheim die Stelle des CEO. Norwegische Analysten bewerten diese Nachfolgeregelung als ein Zeichen für Kontinuität (Knut-Ivar Bakken, Danske Bank) und "wenig dramatisch" (Carl-Emil Kjolas Johannessen, Pareto Securities). Ein Wechsel sei fällig gewesen, denn "zehn Jahre als Top-Manager ist eine lange Zeit", ergänzte Johannessen. Der neue CEO Ivan Vindheim versichert: "The show goes on."11.11.2019
Peru: Fangquote 2019 für Riesenkalmar um 12% erhöht
Perus Produktionsministerium hat die Fangquote 2019 für den Riesenkalmar (Dosidicus gigas) um 12% von 450.000 t auf 504.000 t angehoben, meldet Fish Information & Services (FIS). Die Anhebung erfolgte auf Empfehlung des peruanischen Meeresinstituts (IMARPE), da die Quote nach Anhebung um 54.000 t nicht die Obergrenze des höchstmöglichen Dauerertrags (Maximum Sustainable Yield - MSY) überschreite.08.11.2019
Schleswig-Holstein: Krabbenfischer verschenken Krabben - aus Protest
Schleswig-Holsteins Krabbenfischer haben heute im Rahmen eines Aktionstages im Büsumer Hafen fangfrische Nordseekrabben verschenkt, meldet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag (SHZ). Unter dem Motto "Spenden statt verschachern" gaben sie die Garnelen gegen Spenden ab, die der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zukommen sollen. Mit der Aktion machten sie auf ihre derzeit prekäre Situation aufmerksam. Bei einem durchschnittlichen Kilopreis von 2,89 Euro und damit erheblich weniger als der Erzeugerpreis von 4,54 Euro/kg im Jahre 2018 kämpften sie "ums Überleben". "Wir haben dieses Jahr 60 Prozent weniger Umsatz als 2018", zitiert der SHZ den Fischer Birger Zetl. Der Umsatz der Erzeugergemeinschaft habe im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt 27 Mio. Euro betragen - aktuell liege er bei gerade einmal 9 Mio. Euro. "Mir fehlen zwischen 80.000 und 90.000 Euro Umsatz dieses Jahr, um auf Null zu kommen", erklärt der Fischer, "ich liege bei 150.000 Euro, das Minimum sind 230.000 Euro." Schiffsreparaturen und Modernisierungen seien bei dieser Umsatzhöhe nicht möglich.08.11.2019
Südkorea: ASC-/MSC-zertifizierter Wakame auch für Deutschland
Eine Farm, die die marine Braunalge Wakame (Undaria pinnatifida) im Meer züchtet, ist jetzt als erste dieser Art in der Republik Südkorea nach dem kombinierten Algen-Standard des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) und Marine Stewardship Council (MSC) zertifiziert worden. Betreiber ist das Gijang Sustainable Seaweed Network mit Sitz im Landkreis Gijang, das den Wakame getrocknet und verarbeitet weltweit für den menschlichen Verzehr verkauft, darunter an Kunden in China, Japan und den USA, aber auch in Deutschland, Skandinavien und Großbritannien. Gijang ist der zweite Produzent, der jetzt nach dem kombinierten ASC-MSC-Algenstandard zertifiziert ist, nachdem die Euglena Co. in Japan, die allerdings nicht im Meer züchtet, als erster ein entsprechendes Zertifikat erhalten hatte. Gijang züchtet den Wakame an Seilen im Meer und erntet von Hand, so dass die Einflüsse auf das umliegende Ökosystem minimal seien. Als Besatz werden auf der Farm produzierte Sporen verwendet, so dass nicht auf wilde Algen zurückgegriffen werden muss. Wakame, seit mehr als 1.000 Jahren in Asien gezüchtet, wird in Miso-Suppen oder in Algensalaten, beliebt in der Sushi-Gastronomie weltweit, gegessen.06.11.2019
Dänemark: Danish Salmon kämpft mit technischen Problemen
Auch wenn der dänische Lachszüchter Danish Salmon im vergangenen Jahr erstmals Gewinn erwirtschaftete, so läuft die landgestützte Farm in Hirtshals noch nicht rund. Diesen Schluss lassen Äußerungen zu, die Geschäftsführer Kim Hieronymus Nielsen im Juni diesen Jahres gegenüber dem Portal Salmonbusiness machte. Das ursprünglich angestrebte Produktionsziel von 2.000 t im Jahr könne in der im Jahre 2012 errichteten Kreislaufanlage nicht erreicht werden, sagte Nielsen. "Wir können hier höchstens 80 bis 100 kg Lachs pro Kubikmeter produzieren. Wollten wir 2.000 t machen, müsstest Du in dieser Anlage 200 kg pro Kubimeter produzieren", teilte der Betreiber mit. Größte Herausforderung sei die Verwendung von Meerwasser, auf das bei weitem nicht alle technischen Komponenten der RAS ausgelegt seien: "Von Jahr zu Jahr wird es teurer und teurer." Doch auch ein Neubau berge Probleme: "Wir brauchen ein neues Design und ein neues Design erfordert eine neue Technik." Aktuell produziere Danish Salmon in der 7.500 Quadratmeter großen Farm 1.200 t im Jahr. Diesen Sommer sei die 20. Charge Lachs geschlachtet worden.05.11.2019
China: Mowi will ersten Konzeptladen "Supreme Salmon" eröffnen
Der weltgrößte Lachsproduzent Mowi will im kommenden Jahr sein erstes "Supreme Salmon"-Konzeptgeschäft in China eröffnen, teilten die Norweger auf der diesjährigen China Fisheries & Seafood Expo mit. Der Laden solle in der Nähe der neuen Fabrik liegen, die Mowi in diesem Jahr in Shanghai in Betrieb genommen hatte, teilte Charlie Wu mit, Geschäftsführer für Mowi im Asien-Pazifik-Raum. 2017 hatte Mowi-COO Ola Brattvoll angekündigt, dass sein Unternehmen über China verteilt letztendlich 2.000 dieser Supreme Salmon-Läden eröffnen wolle. Die Filialen sollen den Verbrauchern Zubereitungstipps liefern, da Lachs in China bislang vor allem als Sashimi in japanischen Restaurants bekannt sei.05.11.2019