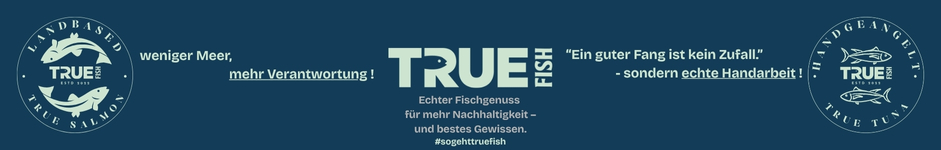10.12.2019
Norwegen: Baubeginn für landgestützte 10.000 t-Lachszucht
Nach anfänglichen Verzögerungen will Havlandet Havbruk jetzt mit dem Bau einer landgestützten Lachszucht in Florø im Westen Norwegens beginnen, meldet IntraFish. Die Farm will zunächst in einer Pilotanlage zwei Lachsgenerationen auf jeweils 5 kg abwachsen lassen, bevor die Fischzucht für die genehmigte Kapazität von insgesamt 10.000 t ausgebaut werden soll. Raum sei sogar für eine Erweiterung auf bis zu 30.000 t Lachs. Die ersten Smolts sollen im 3. Quartal 2020 eingesetzt werden, die erste Ernte ist für das Jahr 2021 avisiert. Konstrukteur der landgestützten Farm ist der norwegische Aquakulturtechniker ScaleAG.10.12.2019
Norwegen: Grünes Licht für geschlossene Mega-Meereslachszucht
Der norwegische Fischzüchter Måsøval Fiskeopdrett hat die behördliche Genehmigung für seine geschlossene marine Lachsfarm "Aqua Semi" erhalten, meldet das Portal IntraFish. "Wir sind jetzt mit der Entwicklung beschäftigt. Die Konstruktion soll im nächsten Jahr beginnen und etwa 18 Monate dauern", teilte Entwicklungsleiter Dr. Arnfinn Aunsmo Anfang Dezember auf dem Aquakultur-Tag des Norwegischen Stahlverbandes mit. Voraussichtlich im Mai 2022 sollen die ersten Fische eingesetzt werden, um sie elf Monate später zu ernten. Måsøval investiert geschätzte 500 Mio. NOK (= 49 Mio. Euro) in die von der norwegischen Schiffbaugruppe Vard konzeptionierte Anlage. Der halbversenkbare Käfig ist mit einer 25 Meter tiefen "Stahlschürze" umgürtet, die das Risiko eines Lachslausbefalls mindern soll. Ein Stahlgitter am Boden des Geheges soll die Gefahr von Ausbrüchen reduzieren. Der Käfig mit einem Durchmesser von 70 Metern und einer Höhe von 40 Metern hat ein Fassungsvermögen von 75.000 Kubikmetern. Die aus 4.000 t Stahl gebaute Farm muss Wellenhöhen von 3,5 Metern standhalten. Sie soll rund um die Uhr mit vier bis sechs Mann Personal besetzt sein. Nach einer Versuchsphase soll die Zuchtanlage an einen bislang noch nicht bestimmten Standort manövriert werden, eventuell in der Region um die Inselkommunen Hitra und Frøya, dem Firmensitz von Måsøval.09.12.2019
Island: Samherji leugnet jede kriminelle Aktivität
Der Interims-Geschäftsführer von Samherji, Björgólfur Jóhannsson, hat in einem weiteren Schreiben an die Beschäftigten des Fischereikonzerns erklärt, dass die Vorwürfe gegen Samherji jeglicher Grundlage entbehrten. "Die Tatsache, dass Cape Cod FS Samherji nie gehört hat, bedeutet, dass die Geldwäsche-Vorwürfe in Verbindung mit Zahlungen des Unternehmens grundlos sind", teilte Jóhannsson den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit, heißt es auf dem Portal IntraFish. Medienangaben zufolge hatte Samherji die Briefkastenfirma Cape Cod FS mehr als sieben Jahre lang genutzt, bevor DNB, die größte norwegische Bank, im Mai 2018 die Konten der Firma auf den Marshallinseln, einem "Steuerparadies", geschlossen hatte. Für die DNB wachse sich der Fall zum größten Skandal seiner Bankgeschichte aus, schreibt IntraFish. Der Samherji-CEO hingegen weist auf Widersprüche hin. So habe der Whistleblower Jóhannes Stefánsson, ehemaliger Samherji-Mitarbeiter, zwischen 2014 und 2016 zwar etwa 44.000 Emails erhalten, hiervon jedoch nur 42 Prozent auf der Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlicht.09.12.2019
Kiel: Kompetenznetzwerk Aquakultur wird nicht fortgesetzt
Das seit dem Jahre 2012 aktive Kompetenznetzwerk Aquakultur (KNAQ) wird nicht fortgesetzt. Das teilte jetzt Dr. Roland Lemcke, Fischereireferent im schleswig-holsteinischen Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung (MELUND) mit. "In zwei Förderphasen […] wurden eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen organisiert, Wissen vermittelt und Interessenten beraten, Forschungsprojekte initiiert und so weiter", teilte Lemcke in einem Brief an die Akteure des KNAQ mit. Allerdings habe es keine Möglichkeit gegeben, das Netzwerk mit öffentlichen Mitteln fortzusetzen. Auch eine Initiative des MELUND zur privaten Finanzierung sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Auf einen Fragebogen bezüglich denkbarer Zukunftsoptionen des KNAQ hätten sich nur rund 2% der registrierten KNAQ-Akteure gemeldet. Lemcke: "Die Bereitschaft, eigene finanzielle Beiträge für die Zukunft des KNAQ zu leisten, war insgesamt so gering - keine 10.000 Euro -, dass sich darauf keine nachhaltige Zukunftsperspektive aufbauen lässt." Fragen rund um die Ansiedlung von Unternehmen der Aquakultur können weiterhin an Nadine Lefering (Landwirtschaftskammer SH) und an Dr. Roland Lemcke (roland.lemcke@melund.landsh.de; Tel.: 0431- 988 49 73) gerichtet werden.08.12.2019
Irland: 14 neue Aquakultur-Lizenzen für Austern und Sandmuscheln
Irlands Landwirtschaftsministerium hat im äußersten Norden der Republik Irland 14 von 18 beantragten Lizenzen für die gemischte Zucht von Pazifischen Austern und Sandmuscheln genehmigt, meldet "Donegal Daily". Die Genehmigungen in der Ballyness Bay (County Donegal) gingen sämtlich an Gruppen oder Einzelpersonen aus Donegal. Sechs Lizenzen hat Joseph Coll (Hillcrest, Meenlaragh/Gortahork) erhalten, zwei wurden Edward und Paul O'Brien (Magheroarty) erteilt, drei Anthony McCafferty (Glasserchoo/Gortahork), zwei Seamus O'Donnell (Ballyconnell/Falcarragh) und eine Tully Shellfish/Redcastle.06.12.2019
Weißfisch: 2020 mehr Alaska-Seelachs, weniger Pazifischer Kabeljau
Das North Pacific Fishery Management Council hat gestern Abend die TAC für den Alaska-Seelachs im östlichen Beringmeer auf 1,425 Mio. t festgelegt - ein Plus von 2% gegenüber der Quote für 2019 in Höhe von 1,397 t, meldet das Portal IntraFish. Gesenkt wurde hingegen die Quote für den Pazifischen Kabeljau im Beringmeer: mit 141.799 t liegt die TAC fast 15% niedriger als die 2019er TAC von 166.475 t. Auch die TAC für den Pazifischen Kabeljau vor den Aleuten-Inseln liegt mit 13.796 t unter jener des laufenden Jahres von 14.214 t (- 2,9%). Die kombinierte Kabeljauquote für die Beringmeer-Fischerei für 2020 ist mit 155.595 t damit 18.333 t oder 11% niedriger als jene für 2019. Für das Jahr 2021 muss mit einer weiteren Reduzierung dieser Kabeljau-Quote gerechnet werden, sollte das Beratergremium des Rates den empfohlenen Akzeptablen biologischen Fang (ABC) von 155.873 t in der Saison 2020 auf 102.975 t senken. 2019 lag der ABC noch bei 181.000 t. Insgesamt hat das Internationale Grundfisch-Forum für 2020 einen leichten Anstieg der zur Verfügung stehenden wichtigsten Weißfischarten von 7,288 Mio. t 2019 auf 7,29 Mio. t 2020 prognostiziert.06.12.2019
England: MSC-Zertifikat für Herzmuscheln aus der Themsemündung
Die englische Herzmuschelfischerei der Leigh Port Partnership in der Themse-Mündung erfüllt die Anforderungen des Marine Stewardship Council-Standards, meldet IntraFish. Ab der kommenden, im Juli 2020 beginnenden Saison dürfen die Herzmuscheln unter dem blau-weißen MSC-Logo verkauft werden. Eine Beschränkung der Erntemenge und eine Einschränkung der Fischerei auf die Monate Juli bis September vor der Küste von Essex bzw. auf den Oktober vor der Küste von Kent gibt den "cockles", so die englische Bezeichnung, hinreichend Zeit, um sich fortzupflanzen. Auch der Nahrungsbedarf von Wildvögeln, die auf den bei Ebbe trockenfallenden Wattbänken überwintern, wird berücksichtigt. Insgesamt 14 Herzmuschelfischer, die von den Häfen Leigh-on-Sea, Essex und Whitstable aus agieren, besitzen eine Fischereilizenz. Die meisten der in der Themse-Mündung gefischten Herzmuscheln - 2017 waren es 3.800 t - werden in die Europäische Union exportiert. Die Fischerei ist die sechste MSC-zertifizierte Herzmuschelfischerei im Nordatlantik und eine von vieren mit MSC-Zertifikat in Großbritannien.06.12.2019
Island: Thai Union investiert in Dorschleber-Produzenten
Die Thai Union Group hat in den isländischen Dorschleber-Produzenten Aegir Seafood Company investiert, meldet IntraFish. Ansässig in Grindavik, produziert Aegir seit rund 25 Jahren Dorschleber von Kabeljau, der aus Fischereien stammt, die nach dem Iceland Responsible Fisheries-Programm (IRF) oder dem MSC-Standard zertifiziert sind. Die Investition soll das Wachstum des Dorschleber-Geschäfts der Thai Union-Marke 'King Oscar' stärken, die im Jahre 2014 von der Thai Union übernommen worden war. Die Norweger verarbeiten auch Sardinen und Makrelen und gehören zu den führenden Fischkonserven-Produzenten in Norwegen, den USA, Polen, Belgien und Australien.05.12.2019
Niederlande: Kingfish Zeeland will Kapazität verdoppeln
Kingfish Zeeland, holländischer Züchter von Gelbschwanzmakrelen, will die Produktionsmenge in seiner landgestützten Farm in den Niederlanden von aktuell 600 t ab kommendem Jahr auf 1.000 t verdoppeln, meldet IntraFish. Darüberhinaus habe Kingfish Kapital akquiriert, insbesondere vom holländischen Investmentfonds Rabobank Corporate Investments und vom französischen Private Equity-Unternehmen Creadev, um an einem neu erworbenen Standort in Jonesport (Maine/USA) für 110 Mio. USD eine weitere RAS-Farm zu errichten. Geplanter Baubeginn: Mai 2021. Dort sollen 6.000 t produziert werden, teilte CEO Ohad Maiman mit. In fünf Jahren will Kingfish Zeeland in Europa und den USA ingesamt über 20.000 t produzieren.05.12.2019