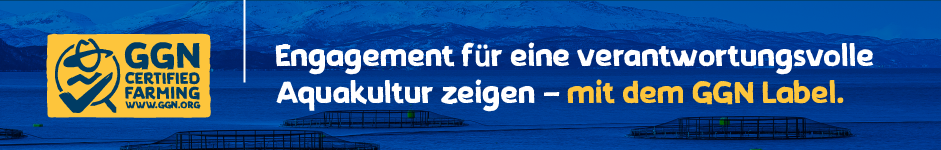08.02.2013
Nutreco: José Villalón wechselt vom WWF zu Nutreco
Der Aquakultur-Experte José Villalón gibt sein Amt als stellvertretender Geschäftsführer beim Aquakultur-Programm des World Wide Fund for Nature (WWF) auf und wechselt zum Futtermittelhersteller Nutreco, meldet das Portal IntraFish. Villalón war bei der Umweltorganisation bisher verantwortlich für die Koordination der so genannten 'Aquakultur-Dialoge', acht runder Tische interessierter Akteure für die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstandards bei gefarmten Fischen und Meerestieren. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender des Aquaculture Stewardship Councils (ASC). Bei Nutreco wird José Villalón für die Umsetzung der weltweiten "Vision Nachhaltigkeit bis 2020" verantwortlich sein.08.02.2013
Kinder: Wettbewerb 'School of Fish' startet 2013 in die zweite Runde
Kinder und Jugendliche essen deutlich weniger Fisch als die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt. Auch im Schulunterricht werde das Thema Ernährung zu wenig behandelt, heißt es in der Studie "So is(s)t Schule". Deshalb führen der Zeitbild Verlag und das Fisch-Informationszentrum (FIZ) auch in diesem Jahr wieder ihre Schulaktion "School of Fish" durch. Warum hilft Fisch beim Lernen? Gibt es ein GPS für Fische? Was sind "Bauernhöfe unter Wasser"? Mit diesen und weiteren Fragen können sich Kinder und Jugendliche unter dem Motto "Macht eure Schule zur School of Fish" bundesweit beschäftigten. Die Schulen sind aufgerufen, fächerübergreifend kreative Ideen für Projekte zum Thema Fisch, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit zu entwickeln. "Mit unserem Projekt möchten wir den Schülerinnen und Schülern alle Wege offen halten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen", sagt Sandra Kess vom FIZ. Die zehn besten Projektideen werden mit je 500,- Euro gefördert, damit die Schülerinnen und Schüler ihre Schulprojekte auch in die Tat umsetzen können. Ideenskizzen, Projektentwürfe oder Konzepte können bis zum 15. Mai 2013 beim Zeitbild Verlag eingereicht werden. Auf der Aktions-Webseite www.school-of-fish.de finden die Schulen alle Infos zum Wettbewerb, Lehrmaterial rund um Fisch, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung sowie einen Animationsfilm.08.02.2013
Miesmuscheln: Gericht verbietet Import von Saatmuscheln
Schleswig-Holsteins Muschelfischer dürfen in Zukunft keine Miesmuscheln aus Gebieten importieren, die außerhalb des schleswig-holsteinischen Wattenmeeres liegen. Mit dieser Entscheidung folgte das Bundesverwaltungsgericht (BVG) in einem aktuellen Urteil (Az.: 4 B 18.12) einer im Dezember 2011 ergangenen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes Schleswig (Az.: 1 LB 19/10) gegen den Import von Saatmuscheln, teilt die Umweltorganisation WWF mit. Hintergrund ist eine Klage, die die Schutzstation Wattenmeer mit Unterstützung vom WWF gegen die Fischereibehörden des Landes eingereicht hatte. Die frühere schleswig-holsteinische Landesregierung hatte über mindestens sechs Jahre gebilligt, dass die Fischereibetriebe für die im Nationalpark gelegenen Kulturflächen junge Miesmuscheln importiert hatten - insbesondere aus Irland, Großbritannien und Niedersachsen -, weil im Wattenmeer selbst zu wenig Muscheln vorkommen.07.02.2013
Vietnam: DKSH-Partner Anvifish ist ASC-zertifiziert
Anvifish, viertgrößter Pangasius-Züchter in Vietnam, ist im November 2012 nach den Standards des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) zertifiziert worden. Das teilt der Asien-Spezialist DKSH mit, seit dem Jahre 2004 Partner von Anvifish. DKSH hat Anvifish beim Zertifizierungsprozess finanziell unterstützt und stand mit technischen Mitarbeitern beratend zur Seite. Anvifish besitzt 100 Hektar eigene Pangasius-Farmen, in deren Teichen rund 50.000 t Pangasius gefarmt werden. Hauptabsatzmärkte für den vietnamesischen Produzenten sind die EU (Schwerpunkt: Spanien, Deutschland, Frankreich) sowie die USA und Australien. Der Jahresumsatz 2012 betrug 85 Mio. USD. DKSH ist seit 1890 in Vietnam vertreten und hat dort inzwischen etwa 3.000 Mitarbeiter, die auch im Seafood-Bereich tätig sind.07.02.2013
Lerøy: Führender Lachszüchter verlässt Chile
Die Lerøy Seafood Group (LSG) hat ihr einziges chilenisches Tochterunternehmen, Pacific Seafood, einschließlich sämtlicher Produktionslizenzen für die Lachszucht verkauft, teilte der weltweit zweitgrößte Lachszüchter gestern mit. Lerøy, ein Tochterunternehmen des norwegischen Seafood-Giganten Austevoll (2011: 7.532 Beschäftigte, 1,635 Mrd. Euro Umsatz), hatte die Lizenzen 2007 erworben. 2011 produzierte der norwegische Lachs- und Forellenzüchter Lerøy insgesamt 147.600 t und damit 13 Prozent mehr als 2010.07.02.2013
MSC senkt Lizenzgebühren in der Lieferkette
Der Marine Stewardship Council (MSC) senkt zum 1. April 2013 seine Gebühren für Lizenzinhaber des Umweltsiegels. 'Der MSC hat auf das Feedback seiner Interessengruppen reagiert. Mit der neuen Gebührenstruktur werden die Gesamtkosten für die Teilnahme am MSC-Programm reduziert", teilt MSC-Hauptgeschäftsführer Rupert Howes mit. An die Stelle der derzeitigen festen prozentualen Abgaben auf Basis des tatsächlichen Umsatzes von MSC-Produkten tritt eine gestaffelte Volumenlizenzgebühr, die die effektiven Logonutzungsgebühren verringere. Kleinere unabhängige Fischfachhandelsgeschäfte und Fischrestaurants, die MSC-Fischprodukte im Großhandelswert von weniger als 200.000 USD bzw. 125.000 GBP - nicht ganz 150.000 Euro - handeln, zahlen in Zukunft eine feste Jahresgebühr von 250,- USD, etwa 185,- Euro, statt wie bislang einen Prozentsatz des Umsatzes. Die mengenabhängigen Logonutzungsgebühren entfallen für Unternehmen dieser Kategorie. Damit wird das MSC-Programm für diese Firmen attraktiver, zumal die Kosten kalkulierbar sind. Eine weitere Änderung: die an den Umsatz mit MSC-Produkten geknüpfte Lizenzgebühr von bislang fix 0,5 Prozent soll in Zukunft mit steigendem Verkaufswert und wachsender Zahl zertifizierter Produkte im Sortiment sinken. Auf diese Weise profitierten sowohl große als auch kleinere Fischhandelsunternehmen, meint der MSC.07.02.2013
Island: Erneut mehr als 25.000 Tonnen Heringe verendet
Im Westen Islands sind zum zweiten Mal innerhalb von zwei Monaten Zehntausende Tonnen Hering in einem Fjord verendet, meldet die Icelandic Review. Schon im Dezember letzten Jahres waren im Kolgrafafjör∂ur, einem kleinen Fjord im Nordwesten der Halbinsel Snæfellsnes, geschätzte 25.000 bis 30.000 Hering offenbar aufgrund von Sauerstoffmangel gestorben. Als Ursache werden eine Auffüllung und der Bau einer Brücke durch den Fjord vor acht Jahren vermutet. Bei dem neuerlichen Vorkommnis sollen etwa ebensoviele Heringe verendet sein.06.02.2013
TST: Tiefkühl-Produzent will auch Großverbraucher beliefern
Schon bevor 'The Seafood Traders' (TST) im Oktober 2012 ihre hochmoderne 40 Mio. Euro-Fabrik in Riepe in Betrieb genommen hatten, produzierte der Tiefkühlproduzent Unruhe in der Branche. In einem Produktsegment, das schon von Überkapazitäten gekennzeichnet war, wurde der neue Wettbewerber nicht freudig begrüßt - Mitspieler wie Royal Greenland und Frosta intensivierten ihren Wettbewerb. Hatten Annegret Kattau-Keck, Andrea Meyer und Regina Gonzalez bei der Gründung im April 2011 noch den Aufbau "eines kleines Handelsunternehmens" im Auge, so sollen aus Riepe in diesem Jahr 30.000 t Fischstäbchen, Schlemmerfilets und panierte Fischprodukte kommen. Doch die Kapazität des mit Geldern des japanischen Seafood-Giganten Nissui finanzierten Betriebes liegt im Drei-Schicht-Betrieb sogar bei 90.000 t, sagt Kattau-Keck.06.02.2013
Thailand: Garnelen-Produktion 2013 bis zu 30 Prozent niedriger
Die Garnelen-Produktion des weltgrößten Erzeugers Thailand könnte in diesem Jahr um bis zu 30 Prozent niedriger ausfallen als im Vorjahr, meldet Fish Information & Services (FIS). Ursache ist die Krankheit EMS - das Akute Hepatopankreatische Nekrose-Syndrom (AHPNS) -, die zu hohen Verlusten in Farmen im Osten und Süden des Landes führt. Ein Dokument, das an die Mitglieder des Verbandes der thailändischen Tiefkühlindustrie (TFFA) versendet worden ist, spricht von einem Produktionsrückgang gegenüber dem Vorjahr von 20 bis 30 Prozent.06.02.2013