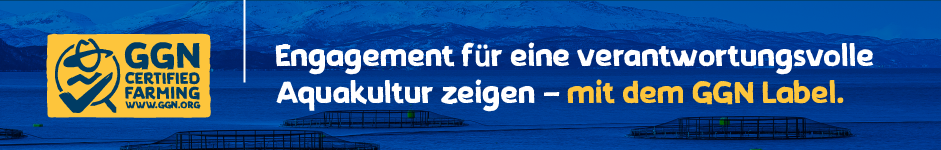15.02.2013
EU erlaubt wieder Verwendung tierischer Proteine in Fischfutter
Die Europäische Kommission hat die begrenzte Verwendung von verarbeiteten tierischen Proteinen (PAP) in Fischfutter wieder erlaubt, meldet das Portal IntraFish. Ab dem 1. Juni 2013 dürfen Proteine von Nichtwiederkäuern wieder an Fische verfüttert werden. Hinter dem Begriff PAP (processed animal proteins) verbirgt sich eine bestimmte Kategorie von tierischen Eiweißen und Schlachtnebenerzeugnissen. Seit 2002 werden solche Stoffe in drei Kategorien eingeteilt: Kategorie 1 - spezifiziertes Risikomaterial, Kategorie 2 - nicht genusstaugliche Schlachtabfälle und Kategorie 3 - genusstaugliche Schlachtkörperteile. Bei den wiederzugelassenen PAP darf nur Material der Kategorie 3 eingesetzt werden. Der Einsatz dieser Proteine war im Zuge der BSE-Krise 2001 für sämtliche Tiere verboten worden. Aus ökologischer Sicht ist es jedoch nachhaltig, sie für die Tierernährung zu nutzen. Die durch das Verfütterungsverbot entstandene Eiweißlücke muss bislang durch Importe aus Drittländern gedeckt werden, erklärt der Deutsche Verband Tiernahrung (DVT). Fachleute versprechen sich von der Lockerung insofern auch eine Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von Nutztierhaltern.15.02.2013
Thailand will Arbeitsbedingungen in der Fischwirtschaft verbessern
Nachdem Thailands Fischindustrie jüngst durch Arbeitsrechtsverstöße in die Kritik geraten war, haben Regierung und Seafood-Branche des Landes Reformen in diesem Bereich angekündigt, schreibt die Bangkok Post. Damit reagiere Thailand auf Vorbereitungen der USA, Thailands Status auf der so genannten "Tier 2 watch list" zum Menschenhandel noch in diesem Monat zu überprüfen. Gemeinsam hätten Thailands Arbeitsministerium, die Internationale Arbeitsorganisation (ILO) sowie Unternehmen der Fischwirtschaft und der Fischerei sich darauf geeinigt, Beschäftigte in Zukunft zu registrieren, Arbeitsverträge abzuschließen sowie Kinder- und Zwangsarbeit zu verbieten. Die Beteiligten haben Standards über gute Arbeitsbedingungen (Good Labour Practices - GLPs) für Beschäftigte in den Fischereihäfen, Fischfarmen, Fischfabriken und auf den Fangbooten ausgearbeitet. In den Häfen sollen die GLPs schon im März eingeführt werden, in Zuchten, Fabriken und auf den Booten bis Juni. In Zukunft sollen Besatzungsmitglieder beispielsweise einmal im Monat ihre Familien anrufen dürfen. Praphan Simasanti, Berater der Thai Frozen Foods Association, sagte, mittlere und große Unternehmen könnten sich an die GLPs schon jetzt halten, während Kleinbetriebe der Küstenfischerei über diese Arbeitsbedingungen erst einmal informiert werden müssten und dann bis zu drei Jahre benötigten, um sie umzusetzen.15.02.2013
Bremerhaven: Kurt Ehlerding im Alter von 84 Jahren gestorben
Der frühere Bremerhavener Krabbengroßhändler Kurt Ehlerding ist tot. Er starb bereits am 26. Dezember 2012 im Alter von 84 Jahren in Bremerhaven. Kurt Ehlerding war 1962 als Mitinhaber in die von seinem Vater Ernst Ehlerding 1926 gegründete Fisch- und Krabbengroßhandlung eingestiegen und hatte sie 1971 von Vater und Onkel übernommen. 1989 - inzwischen als "Kurt Ehlerding Krabbengroßhandel" - nahm er eine der ersten und damals modernsten Krabbenschälmaschinen des Herstellers Alwin Kocken aus Spieka-Nordholz in Betrieb, so dass kein Krabbenfleisch mehr im Ausland produziert werden musste. 1994 übergab Kurt Ehlerding den Betrieb an seine Tochter Heike Lankenau und ihren Mann Jörg. Zehn Jahre später musste das Unternehmen Insolvenz anmelden und wurde von dem Krabbengroßhandel Kocken übernommen, der am Standort Bremerhaven seitdem als "Kocken & Ehlerding Krabbenhandels-GmbH" firmiert. Ebenfalls am 26. Dezember starb in Spanien Kurt Ehlerdings Tochter Maren Loskot (* 1956). Beide wurden am Sonnabend, dem 26. Januar, auf See bestattet.14.02.2013
Kaltenkirchen: Popp baut neues Produktionsgebäude
Popp-Feinkost, Hersteller auch von Fischspezialitäten, baut am Sitz in Kaltenkirchen für 10 Mio. Euro ein neues Produktionsgebäude mit Lagerflächen, schreiben die Kieler Nachrichten. Weil Popp Platz benötigt, wurde außerdem ein Gebäude in der benachbarten Süderstraße angemietet. Mit dem Neubau gebe Popp ein klares Bekenntnis zum schleswig-holsteinischen Standort, bekräftigt Geschäftsführer Philip Harland. Der 41-Jährige ist seit August 2012 Nachfolger von Geschäftsführer Dietrich Tetz, der mit 65 in den Ruhestand trat, und zuständig für Vertrieb und Marketing. Zweiter Geschäftsführer ist Dr. Jens Kremer, der sich um Einkauf und Produktion kümmert. Der Jurist und gebürtige Lübecker Harland war zuletzt rund zehn Jahre lang Geschäftsführer bei Mayo-Feinkost in Lübeck. Als Mayo im vergangenen Jahr von Popp übernommen wurde, stieg Philip Harland in die Geschäftsführung der Muttergesellschaft auf. Popp beschäftigt in Kaltenkirchen etwa 400 Mitarbeiter, davon die Hälfte in der Produktion.14.02.2013
Argentinien: Höhere Quoten für Seehecht und Blauen Wittling
In Argentinien liegen die diesjährigen Fangquoten für die verschiedenen Seehecht-Arten und den Blauen Wittling über den tatsächlichen Fangmengen des Jahres 2012, meldet Fish Information & Services (FIS). So liegen die Quoten für den Argentinischen Seehecht (Merluccius hubbsi) bei insgesamt 312.000 t. Die individuellen übertragbaren Quoten (CITC) 2013 betragen für den Hoki (Macruronus magellanicus) 94.000 t, für den Schwarzen Seehecht (Dissostichus eleginoides) 3.500 t und jene für den Blauen Wittling (Micromesistius australis) 33.000 t.13.02.2013
Standards für Gelbschwanzmakrele und Offiziersbarsch stehen zur Diskussion
Die Aquakultur-Standards für die Gelbschwanzmakrele (Seriola spp.) und für den Offiziersbarsch (Rachycentron canadum, engl. Cobia) sind so weit entwickelt worden, dass der WWF als Koordinator die erste von zwei öffentlichen, jeweils 60 Tage dauernden Diskussionsphasenzu den Standards eingeleitet hat. "Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, Rückmeldungen zu den Standard-Entwürfen zu liefern, um mögliche negative Auswirkungen der Zucht von Gelbschwanzmakrele und Offiziersbarsch auf die Umwelt, die Farmarbeiter und die örtlichen Gemeinden zu minimieren", erklärt der WWF. Die Entwürfe sind das Ergebnis eines vom WWF koordinierten 'Runden Tischs', an dem Produzenten, Umweltschützer, Wissenschaftler sowie weitere Entscheider aus der Wertschöpfungskette beteiligt sind. Die Standards für Gelbschwanzmakrele und Offiziersbarsch sind der siebte Satz von Standards, die in den 'Aquaculture Dialogues' entwickelt worden sind. Bislang liegen fertige Standards für Pangasius, Tilapia, Seeohr, Muscheln, Lachs und Süßwasserfisch vor. Noch in diesem Jahr sollen definitive Standards für die Shrimp-Zucht vorliegen. Der Gesamtprozess wird vom Aquaculture Stewardship Council (ASC) koordiniert. 2012 kamen als erste ASC-zertifizierte Produkte Pangasius und Tilapia auf den Markt.13.02.2013
Russland: WWF und Alaskas Fischer widersprechen Alaska-Pollack-Zertifizierung
Nachdem am Montag schon die US-amerikanische Vereinigung 'At-Sea Processors Association' (APA) förmlichen Einspruch gegen die Zertifizierung der Alaska-Pollack-Fischerei im Ochotskischen Meer erhoben hatte, hat gestern auch die Umweltorganisation WWF Widerspruch eingelegt, meldet das Portal IntraFish. In seinem Schreiben äußert der WWF Bedenken im Hinblick auf das Bewertungsverfahren des Zertifizierers Intertek Moody Marine: es entspreche nicht den Anforderungen einer MSC-Zertifizierung. Demnach habe der Zertifizierer nicht korrekt Informationen gesammelt, die fischereiliche Sterblichkeit, Beifänge geschützer Arten sowie Einflüsse auf die Umwelt nicht hinreichend streng gemessen, um entscheiden zu können, ob die Fischerei den MSC-Standards entspreche, sagte WWF-Sprecher Daniel Suddaby. Der WWF betonte, dass der Einspruch der APA ähnliche Kritikpunkte thematisiere, dass die beiden Gruppierungen jedoch nicht kooperierten. Im Übrigen bedeute der Einspruch nicht, dass der WWF den Glauben an den MSC als das glaubwürdigste Ökolabel verloren habe. Die russische Alaska-Seelachs-Fischerei im Ochotskischen Meer hat den größten Anteil an der AP-Gesamtquote Russlands, die für 2013 gegenüber 2012 von 1,54 Mio. t auf 1,55 Mio. t angehoben wurde.13.02.2013
Marine Harvest: Kauft weitere Fischfarmen in Schottland
Marine Harvest Scotland, Tochterunternehmen des weltgrößten Lachszüchters, hat auf den Äußeren Hebriden vor der Westküste Schottlands den Lachszüchter Lewis Salmon gekauft, meldet das Portal IntraFish. Für einen nicht genannten Betrag erwarb Marine Harvest zwei Farmstandorte im Loch Leurbost (Insel Lewis) einschließlich der entsprechenden Genehmigungen, außerdem die Netzgehege, Fahrzeuge und weiteres Zubehör ebenso wie die Lachse, die zwischenzeitlich geerntet wurden. Die Zuchten sollen jetzt eine Zeitlang leer stehen, bevor die Käfige neu besetzt werden. Denn ein Grund für den Kauf sei die Erhaltung der Fischgesundheit, erklärte Alan Sutherland, Geschäftsführer von Marine Harvest Scotland: "Wir haben in unseren Farmen sehr strenge Kontrollen, um das Risiko einer Verbreitung von Infektionen oder Lachsläusen zu vermeiden. Deshalb ist es am wirksamsten, wenn wir in einer Bucht sämtliche Zuchten betreiben." Mit einer Produktionsmenge von mehr als 40.000 t im vergangenen Jahr ist Marine Harvest Scotland der größte Züchter in der Region. Das Unternehmen betreibt auf den Äußeren Hebriden, den Inneren Hebriden (Isles of Skye) und auf dem Festland (Wester Ross und Lochaber) vier Brutanstalten, vier Süßwasser-Standorte sowie 28 Meeresfarmen. Der lebende Fisch wird in Mallaig 'angelandet' und in einem Betrieb in Blar Mhor in Fort William eine Autostunde entfernt verarbeitet. Insgesamt sind an allen Standorten 460 Mitarbeiter beschäftigt.13.02.2013
Dänemark: DNA-Verfahren kann Herkunft des Fischs bestimmen
Die Wissenschaft ist inzwischen nicht nur in der Lage, eine Fischart mit Hilfe von Genanalysen zu bestimmen, sondern auch die Meeresregion, aus der ein Fisch stammt. Im dänischen Radio-Programm Natursyn sprach Prof. Dr. Einar Eg Nielsen vom dänischen Meeresforschungsinstitut (DIFRES DTU Aqua) über ein gesamteuropäisches Forschungsprojekt, bei dem diese Bestimmung anhand von DNA-Untersuchungen für Kabeljau, Hering, Seezunge und Seehecht durchgeführt werde. So können die Genforscher beispielsweise nachweisen, ob ein Kabeljau aus der Barentssee stammt, wo sich die Bestände in gutem Zustand befinden, oder aus Nord- oder Ostsee, wo die Kabeljaubestände stärker unter Druck sind.13.02.2013