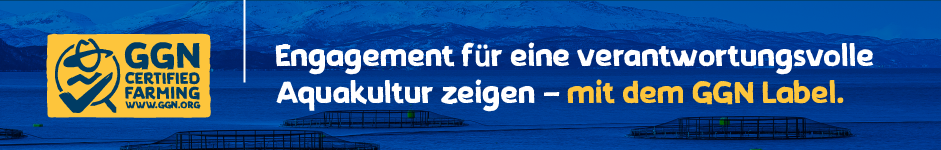03.05.2013
Island: Saisonbeginn für die Küstenfischerei
Bis zu 200 kleine Fischerboote fuhren gestern in Island auf Fangfahrt - am ersten Tag der Küstenfischerei-Saison, die bis in den August dauert, meldet die Icelandic Review. Nach Angaben der Fischereibehörde dürfen die kleinen Boote in dieser Saison etwa 8.610 Tonnen fischen, und zwar 2.375 Tonnen im Mai, 2.655 Tonnen im Juni, 2.365 Tonnen im Juli und noch 1.215 Tonnen im August. Insgesamt sollen derzeit 470 Fangschiffe auf See sein, während es sonst im Schnitt zwischen 250 und 270 seien, berichtet die isländische Küstenwache. Denn neben der Küstenfischerei hat vor kurzem auch die Fischerei auf den Seehasen begonnen.03.05.2013
Russland: Zwei weitere Lachsfischereien starten MSC-Bewertung
Zwei weitere russische Fischereiunternehmen wollen für ihre Aktivitäten offenbar eine Zertifizierung nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) beantragen, meldet IntraFish. Allerdings habe das Verfahren noch nicht offiziell begonnen, korrigierte Gerlinde Geltinger vom MSC Deutschland. Die kooperierenden Fischereigruppen Bolsheretsk und Rybolovetskaya Artel wollen das Nachhaltigkeitslabel für ihre Fischereien auf insgesamt sechs verschiedene Lachsarten westlich der Halbinsel Kamtschatka in der Nähe der Flussmündungen von Bolshava, Kikhchik und Opala. Bei dieser Fischerei im Ochotskischen Meer gehen die Fischer mit Fallen, Stell- sowie Treibnetzen insbesondere auf Buckellachs, Ketalachs, Rotlachs und Silberlachs. Regenbogenforellen und Masu-Lachse ziehen ebenfalls die Flüsse hinauf, sind jedoch ökonomisch kaum von Bedeutung. 2012 landete Bolsheretsk insgesamt 18.959 Tonnen an, während Rybolovetskaya Artel 11.612 Tonnen fischte. Die Produkte - sämtliche Formen TK-Lachs und Rogen, darunter H&G-Blöcke - werden vor allem in Russland vermarktet. Allerdings wollen die Unternehmen auch "Möglichkeiten auf dem Weltmarkt" nutzen. Sollten die beiden Fischereien im Herbst diesen Jahres zertifiziert werden, würde der Anteil MSC-zertifizierter Fischereien an den russischen Lachsfischereien von derzeit 17 auf dann 20 bis 25 Prozent steigen.03.05.2013
Metro Cash & Carry Deutschland verliert vier Prozent Umsatz
Der Umsatz von Metro Cash & Carry Deutschland lag im 1. Quartal 2013 mit 1,1 Mrd. Euro 4,0% niedriger als im Vergleichsquartal 2012. Das teilte die Metro Group gestern in ihrem aktuellen Quartalsbericht mit. International sank der Umsatz von Metro Cash & Carry von Januar bis März um 2,8% auf 7,1 Mrd. Euro. "Bereinigt um den Verkauf von Makro Cash & Carry im Vereinigten Königreich erreichte der Umsatz nahezu das Vorjahresniveau", heißt es im Bericht des Handelsunternehmens. Als Ursache für den Rückgang werden drei fehlende Verkaufstage im Vergleich zum Vorjahreszeitraum angeführt. Insbesondere das Geschäft mit Nicht-Lebensmitteln sei rückläufig gewesen. "Zudem erfolgte im Rahmen des laufenden Transformationsprozesses unter anderem die Umstellung der Werbemaßnahmen hin zu einer zielgruppenspezifischeren Ansprache der Kunden. In dieser Übergangsphase wurde der Werbeaufwand vorübergehend zurückgenommen und belastete damit die Umsatzentwicklung." Das EBIT von Metro Cash & Carry sank im 1. Quartal 2013 von -25 Mio. Euro auf -31 Mio. Euro.03.05.2013
Porta Westfalica: Neue Zander-Aquakultur in der Planung
Zwei Bauunternehmer aus dem westfälischen Porta Westfalica (Kreis Minden-Lübbecke) planen den Bau einer Aquakulturanlage für Zander, schreibt das Mindener Tageblatt. Die Ingenieure Stefan Glammeier und René John, tätig im Dach- und Fassadenbau, wollen im Holtruper Gewerbegebiet auf einer Fläche von zwei Hektar eine Kreislaufanlage errichten, die in einer ersten Ausbaustufe 100 Tonnen Zander pro Jahr produzieren und im Idealfall auf ein Volumen von 500 Tonnen erweitert werden soll. Wasser- und umweltrechtliche Auflagen seien derzeit die entscheidenden Aspekte. Weitere konkrete Angaben wollten die Initiatoren noch nicht machen, da zunächst die Machbarkeit des Projektes überprüft werde. Sollte die Aquakultur-Idee in Holtrup verwirklicht werden, wollen sie auch ihre Baufirma 'Glammeier + John Bausysteme' an den Standort der Fischzucht verlegen.02.05.2013
Norwegen: Marine Harvest will Cermaq für 1,3 Mrd. Euro übernehmen
Marine Harvest hat 4.341.000 Millionen Aktien von Cermaq gekauft, was 4,7 Prozent des Cermaq-Aktienkapitals entspricht. Der weltgrößte Lachszüchter plane, für 1,3 Mrd. Euro auch den Rest des an der Osloer Börse gelisteten Lachsproduzenten zu kaufen, schreibt das Portal IntraFish. Anlass sei die Opposition von Cermaq-Aktionären gegen Pläne, den peruanischen Fischmehlproduzenten Copeinca zu kaufen. Anfang April hatte Cermaq 50,7 Prozent der Copeinca-Aktien übernommen und damit die Eignerfamilie ausgekauft. Marine Harvest wolle für die Cermaq-Aktien 13,80 Euro (105 NOK) bieten - 22 Prozent mehr als der Cermaq-Kurs bei Börsenanschluss am 30. April betrug und sogar 33 Prozent höher als der Durchschnittspreis für die letzten zwölf Monate. Der Betrag sollte hälftig in Marine Harvest-Anteilen sowie in bar gezahlt werden. Allerdings habe Cermaq diese "feindliche Übernahme" abgelehnt, meldet heute morgen die Nachrichtenagentur Reuters. Eine Fusion von Marine Harvest mit einem Umsatz von über zwei Mrd. Euro (2011) und Cermaq mit rund 1,5 Mrd. Euro Handelsvolumen (2012) würde eines der größten Seafood-Unternehmen der Welt schaffen.02.05.2013
Garnelen-Glasur: Eine "Grauzone" zwischen Marktgesetzen und Betrug?
Vor zwei Wochen berichtete das Portal IntraFish über zu hohe Glasuranteile bei gefrorenen Garnelen. Der Versuch, von den genannten Produzenten und Handelsunternehmen Stellungnahmen zu erhalten, stieß auf wenig Resonanz. Auf der Seafood-Messe in Brüssel fragte IntraFish-Mitarbeiterin Elisabeth Fischer mehrere von ihnen, warum bei Probenziehungen die Hälfte der nach Belgien, Frankreich, Deutschland und in die Niederlande importierten TK-Shrimps aufgrund zu hoher Schutzglasur untergewichtig war. "Das ist eine übliche Praxis: es handelt sich um einen Preismarkt, denn Shrimps sind eine Massenware", erklärte der Sprecher eines nicht genannten Unternehmens, dessen Produkte in der Belga Food-Studie negativ aufgefallen waren. Dem widersprach Chris Meskens, Pressesprecher von Heiploeg, dem größten europäischen Shrimp-Importeur. Ein zu hoher Glasuranteil sei nicht notwendig: "Wir glasieren nicht zu viel."02.05.2013
Norwegen: Lachsveredelung fährt hohe Verluste ein
Die hohen Lachs-Rohwarenpreise, die Marine Harvest im 1. Quartal 2013 hohe Gewinne bescherten, führten im Gegenzug im Bereich der Veredelung zu entsprechenden Verlusten, schreibt IntraFish. So notierte Marine Harvests Abteilung für nachgelagerte Veredelung, die 'value added processing unit' (VAP) für die ersten drei Monate Verluste in Höhe von 2,4 Mio. Euro und damit mehr als dreimal soviel wie die 657.000 Euro Minus im 1. Quartal 2012. Bei schwachen Erlösen von 118,9 Mio. Euro lag der Betriebsverlust bei zwei Prozent. Verantwortlich seien insbesondere die Lachsräuchereien des Unternehmens, die alleine ein Minus in Höhe von 3,7 Mio. Euro einfuhren. Insofern kündigte Marine Harvest an, den Herausforderungen im Bereich VAP im zweiten Quartal große Aufmerksamkeit zu widmen. Derweil erhöhten die Norweger ihren Anteil an der polnischen Produktionsgruppe Morpol im 1. Quartal auf 87,1 Prozent und erwarten, die Übernahme im 3. Quartal abzuschließen, sobald die Wettbewerbsbehörde die Fusion geprüft hat.02.05.2013
Österreich: "Austria Sushi" setzt auf heimische Zuchtfische
Das Sushi-Restaurant "Izakaya" im österreichischen Linz setzt seit einem Jahr auf eine neue Sushi-Variante: "Austria Sushi". Die Inhaber Sabine Shirakura und ihr Mann Mario haben das Lokal in der Klammstraße 6 vor zwölf Jahren von Kioyshi Shirakura übernommen, der es 1985 als erstes japanisches Restaurant in Oberösterreich eröffnet hatte. Jetzt verwenden sie für ihr Sushi neben Thunfisch, Garnele und Tintenfisch auch Forelle, Wels und Lachsforelle - sämtlich biozertifiziert - aus der oberösterreichischen Fischzucht Maier in Schiedlberg. "Am Anfang haben die Leute aus Neugier probiert, heute entscheiden sich viele wegen der Überfischung der Meere und dem Bewusstsein für Bio dafür", erzählt Shirakura den Salzburger Nachrichten. Ideelle Unterstützung erhalten die Sushi-Gastronomen von Axel Hein, Fischexperte beim WWF Österreich. Gemeinsam mit dem Biofisch-Pionier Marc Mößmer hatte er im vergangenen Jahr einen Sushi-Ratgeber vorgestellt, in dem auch Varianten mit heimischem Fisch vorschlagen werden - neben Forelle und Saibling auch Flussbarsch und Hecht. "Es gibt meines Wissens aber nur wenige Gastronomen, die sich drübertrauen", sagt Hein.30.04.2013
Fischdiebstahl: Rumänen stehlen Fisch für 10.000 Euro
Eineinhalb Jahre lang hatten Unbekannte aus Teichen im bayerischen Alling wiederholt Fisch gestohlen - insgesamt im Wert von 10.000 Euro. Mitte April konnte die Polizei jetzt anhand von Überwachungsvideos drei Rumänen festnehmen, meldet der Merkur Online. Der Erfolg ist dem Zufall zu verdanken. Einer Polizeistreife war Anfang Februar ein weißer Ford Transit aufgefallen, der nachts durch Germering gut 20 Kilometer westlich von München fuhr. Als sie den Wagen anhielten - er war voller Sperrmüll -, stieg den kontrollierenden Beamten ein seltsamer Geruch in die Nase. Die Quelle: 15 blaue Müllsäcke gefüllt mit Fischen. Da die Inspektion Germering auch für die Gemeinde Alling zuständig ist, erinnerte Polizeihauptkommissar Klaus Frank die Fischdiebstähle. Nachdem Wilderer einen Weiher mit 200 Speisefischen komplett leer gefischt hatten, hatte der Fischzüchter Überwachungskameras installiert. Als ihm Fischdiebe vor die Kamera liefen, übergab er die Filmaufnahmen der Polizei. Bei Durchsicht der Filme identifizierten die Beamten jetzt die Rumänen aus dem Transporter als die aufgezeichneten Fischwilderer - auf frischer Tat mit Keschern und Beuteln. Die getarnten Kameras hatten die Diebe nicht bemerkt.30.04.2013