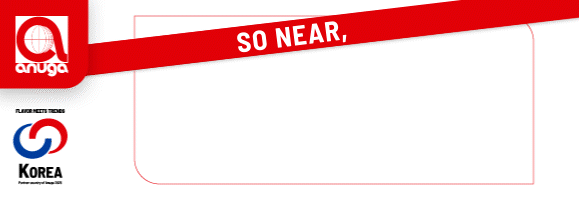10.05.2010
Dänemark: „Hering des Jahres 2010“ mit Chili und Heidehonig
Das Restaurant ‚Lilleheden’ im dänischen Hirtshals hat den diesjährigen Preis „Hering des Jahres 2010“ erhalten, meldet die dänische Botschaft in Berlin. Aus fünf verschiedenen Heringsprodukten, die zum Thema „Hering zu jeder Zeit“ eingereicht worden war, wählten die Preisrichter die Rezeptur des Gastronomen Ejvind Jensen. Grundlage ist ein von dem Heringsverarbeiter Lykkeberg in Salz, Zucker und Essig marinierter Hering, den der Sieger mit einer sorgfältig dosierten Mischung aus Aprikose, Vanille, Schalotten, Ingwer, Chili und Heidehonig verfeinerte. Schon in diesem Monat soll das Produkt im dänischen Lebensmittelhandel erhältlich sein. Der Wettbewerb wurde zum 16. Mal vom Nordsoen Oceanarium und Hirtshals Kulinariske Sildeslag verliehen. Die diesjährige fünfköpfige Jury setzte sich zusammen aus der dänischen Außenministerin Lene Espersen, Schauspieler Per Pallesen, Küchenchef Kristian Rise vom Brauhaus Vendia in Hjoerring, dem Gastwirt Thomas Riis vom Restaurant Messen in Skallerup Klit sowie als Vorsitzendem dem früheren Auktionator in Hirtshals, Knud Damsgaard.10.05.2010
Mexiko: Thunfischerei vor Baja California startet Zertifizierung
Die mexikanische Fischerei auf Gelbflossen-Thun (Thunnus albacares) und auf Echten Bonito (Katsuwonus pelamis) von Baja California ist in das Hauptbewertungsverfahren nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) eingetreten. Ganzjährig fangen dort vor der Küste des nordwestlichsten mexikanischen Bundesstaats in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (EEZ) des Landes zwei Fangschiffe mit pole and line rund 555 t (2008). Bisher wurde der Thun im Hafen von Matancitas zu Konserven verarbeitet und in Mexiko verkauft. Antragsteller für die Zertifizierung ist Productos Pesqueros de Matancitas S.A.07.05.2010
Frosta mit leichtem Umsatzrückgang - Ergebnis jedoch über Vorjahr
Der Umsatz der Frosta AG war in den ersten vier Monaten des Jahres 2010 leicht rückläufig. Das meldete das Unternehmen heute im Zwischenbericht über den Geschäftsverlauf. Der Rückgang betrifft hauptsächlich den Bereich der Handelsmarken, in dem man sich sowohl im Inland als auch im Ausland von unprofitablen Kontrakten gelöst habe. Dagegen habe die Marke Frosta in Deutschland ihre Marktführerschaft für tiefgekühlte Fertiggerichte und in Polen für Tiefkühlfisch ausbauen können. Der Jahresüberschuss liegt in den ersten Monaten des Jahres 2010 über dem des Vorjahres. Die Finanzlage ist solide. Die Eigenkapitalquote konnte weiter gesteigert werden.07.05.2010
Lachs: Marine Harvest eröffnet Frischproduktion in Japan
Marine Harvest hat in der Nähe der japanischen Hauptstadt Tokio eine Verarbeitung für Frischlachs in Betrieb genommen, meldet das Portal IntraFish. Die Lachsfilets mit Stehgräten werden aus Norwegen über den internationalen Flughafen Narita eingeflogen. Während des Transports durchlaufen sie das Rigor-Mortis-Stadium. „Damit können wir Japan jetzt mit frischestmöglichen Filets beliefern“, sagte Marketing-Direktor Jørgen Christiansen. Der Betrieb mit einer Kapazität von zunächst 3.000 t (HOG – ausgenommen, mit Kopf) soll Fehlmengen aus Chile ausgleichen, die das südamerikanische Land aufgrund der ISA-Verluste nicht mehr liefern kann.06.05.2010
Spanien: Weltgrößte Frischfisch-Fabrik setzt auf MSC
Das spanische Fischfang- und Fischverarbeitungsunternehmen Caladero baut in Zaragoza derzeit die mutmaßlich größte Frischfisch-Produktion der Welt, schreibt IntraFish. Caladero, das bislang nur auf dem heimischen spanischen Markt verkauft, will mittelfristig 30 Prozent exportieren, kündigt Generaldirektor Carlos Amoros Lopez de la Nieta an. Insbesondere für Zielmärkte wie Großbritannien, Italien, Frankreich und Deutschland sollen MSC-Produkte in MAP-Verpackung angeboten werden. Als Fangunternehmen mit 14 eigenen Langleinen-Fängern, die vor Südafrika und Namibia operieren, ist Caladero einer der größten Quoteninhaber für MSC-zertifizierten Kap-Seehecht. Anfang April hatte der Produzent auch eine MSC-Zertifizierung für seine Produktkette erhalten, teilt Marketing-Direktorin Isabel Boix mit. Caladero baut derzeit für 110 Mio. € eine Frischfisch-Verarbeitung von 5.400 Quadratmetern. Nach Erreichen der vollen Kapazität können dort ab Ende 2011 täglich bis zu 750.000 MAP-Produkte von Seehecht, Lachs, Wolfsbarsch und Dorade sowie weiteren Arten produziert werden. Der Umsatz von zuletzt 548 Mio. € (2009) soll über geplante 600 Mio. € im laufenden Jahr auf schließlich 900 Mio. € zulegen.06.05.2010
Husum: Ausstellung zur Fischerei
Eine Sonderausstellung zur Fischerei im Nordseehafen Husum zeigt das Schiffahrtsmuseum Nordfriesland in der Storm-Stadt noch bis Ende August, meldet der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag. „Eine traditionelle Fischerstadt ist Husum nicht. Erst 1911 haben sich fünf Fischerfamilien aus Büsum hier angesiedelt - das war der Beginn der Berufsfischerei“, erklärt Ausstellungsmacher Uwe Seier (83). 1945 war mit 45 Kuttern die Höchstzahl an Fischereifahrzeugen in Husum erreicht. Der frühere Ingenieur Seier hat die Unterlagen zur Husumer Seefischerei in der Staatsbibliothek Leipzig als Grundstock für die Schau und für eine Buchpublikation genutzt, die schon als Vorabversion existiert. „Husumer Fischereiwesen - Eine Chronik der Husumer Fischer seit 1916“ schlägt auf Schautafeln, mit vielen Bildern illustriert, einen Bogen von den Anfängen der Fangflotte bis zur „Zukunft der Fischer im Weltnaturerbe“. Schiffsmodelle, Ausrüstungsgegenstände, Fangbeispiele und der Nachbau eines Kutter-Führungsstandes mit Navigationsgeräten veranschaulichen die Geschichte. Insbesondere eine Sonderschau über die ehemals vorgesehene Teilnahme von Husumer Kuttern an der 1940 geplanten Invasion Englands ziehe auch Besucher von weither, sagt Museumsleiterin Karin Cohrs.06.05.2010
Bottrop: Kamps Food AG wird Nadler-Verwaltung schließen
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
05.05.2010
Tilapia: Preise auf dem US-Markt fallen
Die Preise für Tilapia-Produkte - sowohl für frische als auch für gefrorene - lagen in den USA im ersten Quartal dieses Jahres 10 Prozent unter jenen des Vorjahreszeitraumes. Das schreibt FAO-Autorin Helga Josupeit in einem im April erschienenen Globefish-Bericht. Hauptursache sei, dass der führende Tilapia-Produzent China seine Produktion weiter gesteigert habe und viel Ware in den US-Markt drücke. China hatte seine Produktion von 1,13 Mio. t im Jahre 2007 und 1,11 Mio. t im Krisenjahr 2008 auf zuletzt 1,15 Mio. t 2009 gesteigert. Die Exporte stiegen im vergangenen Jahr um 15 Prozent auf 259.000 t. Die Exporterlöse lagen 2009 allerdings mit 538 Mio. € niedriger als im Vorjahr, da der Kilogramm-Preis um 16 Prozent auf durchschnittlich 2,08 €/kg gesunken war. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass 2008 ein Jahr mit sehr wenig Ware am Markt war und dass der Preisrückgang 2009 auch als Anpassung der Märkte an ein ‚normales Preis-Niveau’ gewertet werden kann“, urteilt Helga Josupeit. Fast die Hälfte der chinesischen Tilapia-Ausfuhr geht in die USA, weitere 36.000 t nach Mexiko. Russland als drittwichtigstes Käuferland steigerte seine Einfuhr auf 21.900 t, um geringere Pangasius-Exporte aus Vietnam auszugleichen. Die Europäische Union entwickelt sich als Markt für chinesischen Tilapia nur langsam: 2009 führten die EU-Länder 14.000 t ein gegenüber 5.500 t im Jahre 2006. Hauptimporteure sind Deutschland, Belgien, Frankreich und Großbritannien.05.05.2010
Mexiko erwartete Rekordernte bei Shrimps
Im mexikanischen Bundesstaat Sonora, der wichtigsten Produktionsregion des Landes für Shrimps, wird für 2010 mit einer Rekordernte von bis zu 95.000 t gerechnet, meldet Fish Information & Services (FIS). Insgesamt sollen in diesem Jahr 22.000 Hektar Farmfläche bewirtschaftet werden. Ein Sprecher des Untersekretariats für Fischerei im Landwirtschaftsministerium SAGARHPA, Prisciliano Melendrez Barrios, erwartet, dass die Flächenerträge über jenen 3,6 t pro Hektar liegen werden, die 2009 erzielt wurden. Im vergangenen Jahr erreichte der Gesamtwert der Ernte 300 Mio. USD.05.05.2010