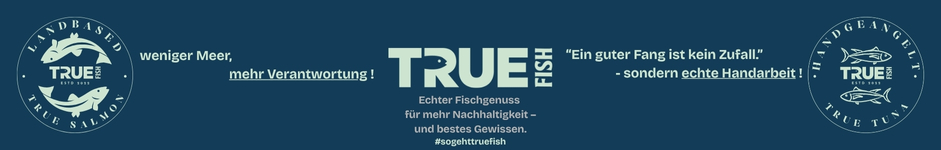08.07.2010
Island: Das meiste Walfleisch liegt noch in den Kühlhäusern
Im Januar 2009 hatte Islands Fischereiminister Einar K. Gudfinnsson die Jagd auf Finwale wieder zugelassen. Der Verkauf des Fleischs würde jährlich bis zu 31 Mio. € Devisen erbringen, hatte der Minister prognostiziert. Neue Zahlen von Statistics Iceland zeigen jetzt, dass bislang nur 372 t nach Japan exportiert wurden. Das sei ein Viertel des Fleischs jener 125 Finwale, die Hvalur hf. in isländischen Gewässern erlegt hatte, schreibt die Iceland Review. Gut 1.100 t Walprodukte liegen weiterhin in isländischen Kühlhäusern. Der Verkauf der 372 t sowie von weiteren 80 t im Jahre 2008 hatte Einnahmen von 5,1 Mio. € erbracht. Damit sei man dem von Gudfinnsson avisierten Betrag „nicht besonders nahe gekommen“, kommentierte Arni Finnsson, Vorsitzender des isländischen Naturschutzverbands. Kristjan Loftsson, Geschäftsführer des Fangunternehmens Hvalur, erklärte, man könne das Fleisch unmöglich alles auf einmal nach Japan exportieren, sondern nur sukzessive. Deshalb liege es noch in den Kühlhäusern. Die Berichterstattung über das Exportprozedere des Walfleischs kritisierte Loftsson als „Spionage“: die Walindustrie brauche Ruhe um arbeiten zu können.07.07.2010
Mosambik: Drei spanische Trawler ohne Fangmeldung erwischt
Die Fischereiaufsicht des ostafrikanischen Staates Mosambik hat drei spanische Langleinenfänger bei Inspektionen in 14 Fällen ohne jede Fangmeldung an Bord erwischt, schreibt das Portal IntraFish. Die drei Schiffe des Fischereiunternehmens Organizacion de Palangreros Guardeses (OR.PA.GU) fischten im Rahmen des seit 2007 zwischen der EU und Mosambik bestehenden Fischereiabkommens (FPA) auf Thun, Schwertfisch, Blauhai und Makrelenhai. Sowohl das Abkommen wie auch das nationale Fischereirecht Mosambiks sehen vor, dass bei Eintritt in die und Verlassen der AWZ des Landes detaillierte Angaben über die Fänge vorliegen müssen. Ist dies nicht der Fall, sieht das Gesetz Sanktionsmöglichkeiten von der Beschlagnahmung des Fanges bis zum Einzug der Fanglizenz vor.07.07.2010
Spanien: Erste Fischerei lässt sich nach MSC-Standards prüfen
Das spanische Fischereiunternehmen Grupo Regal lässt seine Langleinen-Fischerei auf Seehecht im Nordost-Atlantik nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) prüfen. Sollte die unabhängige Organisation Food Certification International die Fischerei als nachhaltig und gut gemanaged einstufen, darf Grupo Regal seine Fangmenge von jährlich rund 1.100 t, gefischt mit zwei Booten, unter dem blauweißen Logo des MSC vermarkten. Im Rahmen dieses MSC-Verfahrens wird der Status des gesamten nördlichen Seehecht-Bestandes überprüft. Grupo Regal hat angekündigt, dass sich im Falle einer erfolgreichen Zertifizierung auch die anderen lizenzierten, etwa 50 spanischen Langleinenfänger an dem Zertifikat beteiligen können. Von der gesamten EU-TAC für Seehecht (51.500 t für 2010) halten spanische Schiffe etwa 11.000 t. Der Seehecht wird fast ausschließlich (zu 98 Prozent) auf dem heimischen Markt verkauft, etwa zwei Prozent nach Frankreich exportiert. Für Nicolas Guichoux, Regionaldirektor des MSC für Europa, ist Spaniens Eintritt ins MSC-Programm eine Meilenstein, zumal der Seehecht eine der in Europa beliebtesten Konsumfischarten ist.06.07.2010
Deutsch-dänische Fischereikontrolle: „Hohe Zahl von Beanstandungen“
Die dänische Fischereiaufsicht und die Wasserschutzpolizei Schleswig-Holstein führten Ende Mai eine gemeinsame Kontrolle auf der Flensburger Förde, der Sonderburger Bucht und der Geltinger Bucht durch. Innerhalb von zwölf Stunden wurden über 100 Fischereikontrollen durchgeführt. Dabei wurden 44 Fischereigeräte beanstandet und größtenteils eingezogen. Der Chef der dänischen Fischereiaufsicht in Fredericia zeigte sich enttäuscht über die hohe Zahl dänischer Berufsfischer, die Grund zur Beanstandung ihrer Fanggeräte gaben, teilte das Landespolizeiamt Schleswig-Holstein mit.06.07.2010
Kanada: Drei Rotlachs-Fischereien haben MSC-Zertifikat erhalten
Drei westkanadische Fischereien auf Rotlachs (Oncorhynchus nerka) sind vom Marine Stewardship Council (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifiziert worden, teilt der MSC mit. Die Rotlachs-Fischerei in British Columbia (B.C.) ist geographisch in vier Regionen unterteilt. Zertifiziert wurden die Skeena-Fischerei, die Lachs fängt, der in das Einzugsgebiet des Skeena Rivers zurückkehrt, die Nass-Fischerei, die zur Wasserscheide des Nass Rivers kommt, sowie die Fischerei im Barkley Sound. Das vierte Gebiet um den Fraser River befindet sich noch in der Prüfung, zumal Interessengruppen Einspruch gegen eine Zertifizierung der dortigen Fischerei erhoben haben. In allen drei jetzt zertifizierten Einheiten wurden marine Fischereien mit Schleppnetz, Kiemennetz und Troll zertifiziert, außerdem weitere Fangmethoden im Bereich der Süßwasserfischerei. Einige werden von indianischen Ureinwohnern betrieben, den First Nations, die meisten sind kommerzielle nicht-indianische Fischereien. Sichere Aussagen hinsichtlich der Fangmengen sind angesichts der jahresabhängig sehr starken Schwankungen – im letzten Jahrzehnt um den Faktor 11 nach Menge und Wert - nicht möglich. Der Rotlachs aus B.C. wird überwiegend gefroren und als Konserve exportiert, nur etwa zehn Prozent werden frisch verkauft. Japan nimmt 90 Prozent der TK-Ware ab, während mehr als 80 Prozent der Rotlachs-Konserven nach Großbritannien verkauft werden.05.07.2010
EU: Euro-Blatt als neues EU-Bio-Logo
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
05.07.2010
Norwegen: Lachszüchter verdoppeln Profite
Norwegens Lachsfarmer haben in den ersten fünf Monaten diesen Jahres doppelt soviele Profite erwirtschaftet wie im gleichen Zeitraum 2009, schreibt das Portal IntraFish. Ragnar Nystoyl, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts Kontali Analyse, gab auf der Midtnorsk-Fischereikonferenz in Kristiansund aktuelle Zahlen bekannt. Demnach wurde bis Mai einschließlich Lachs im Wert von 1,4 Mrd. € exportiert, wobei 508,5 Mio. € Gewinn erzielt wurden. 2009 waren bis Mai einschließlich 292,4 Mio. € Gewinn erlöst worden. Der Durchschnittpreis lag in den ersten fünf Monaten 2010 bei 4,45 €/kg (35 NOK). Kontali halte es für möglich, dass die Schlachtmenge in Norwegen dieses Jahr die Marke von einer Million Tonnen überschreiten könne. Doch Nystoyl betonte: auch wenn das Geschäft derzeit „brumme“, werde nichts „ewig dauern“. Chiles Produktion von Atlantischem Lachs war von einer Spitzenmenge von etwa 400.000 t auf 235.000 t im vergangenen Jahr und nur noch etwa 135.000 t im laufenden Jahr eingebrochen. „Vom kommenden Jahr an wird sich das wieder in die andere Richtung entwickeln“, kündigte Nystoyl an.05.07.2010
Wasserreinigung: Katar will mit Know-how aus Sachsen Fisch züchten
Der Golfstaat Katar gilt als unfruchtbar und verödet, noch unwirtlicher als die anderen arabischen Wüstenstaaten. Jetzt soll in dem wasserarmen Land eventuell Fisch gezüchtet werden - mit technischem Wissen aus Sachsen, schreibt das Agrar-Nachrichtenportal Proplanta. Katars Minister für Handel und internationale Kooperation, Dr. Khalid bin Mohamed Al-Attiya, will im Herbst eine Delegation des Landes nach Deutschland schicken, die sich unter anderem für die Wasserreinigungstechnologie des Leipziger Ingenieurunternehmens Busse interessiert. Mit der Technologie sei auch Fischzucht in wasserarmen Gegenden möglich. Dipl.-Ing. Ralf-Peter Busse habe mit Hilfe des Umweltbundesamtes ein Verfahren entwickelt, das keinen Wasseraustausch mehr verlange. Das Wasser wird durch feinste Biomembranen flltriert. Bakterien, Viren und Rückstände von Futterzusatzstoffen sowie Medikamenten werden auf diese Weise entfernt. Ein deutsches Referenzprojekt für die innovative Technik ist die Fischzucht am ehemaligen Braunkohlekraft Thierbach 20 Kilometer südlich von Leipzig. Anlass für die Entwicklung der Membrantechnik war für Ralf-Peter Busse übrigens die fehlende Kanalisation am Wohn- und späteren Firmensitz Leipzig-Baalsdorf: schon Mitte der 1990er Jahre baute er seine Hauskläranlage mit einer Membrantechnik.02.07.2010
Schweiz: Störzucht Frutigen verliert eine Million Filterteilchen
Aus einem Klärbecken der Störzucht im Schweizer Tropenhaus Frutigen sind nach einer Panne etwa eine Million Filterteilchen in den Thunersee gespült worden, meldet das Thuner Tagblatt. Der Vorfall hatte sich schon am 17. Juni ereignet. Die Tropenhaus-Mitarbeiter erfuhren aber erst zwölf Tage später durch einen Anruf der Kantonspolizei von dem Malheur. „Am 17. Juni ging in einem Klärbecken die Pumpe kaputt, worauf das Waser über das Absperrgitter via den Überlauf in die Engstlige geriet“, erläutert Tropenhaus-Geschäftsführer Beat Schmidt. Dabei wurden auch Kunststoffteilchen, mit denen das Wasser aus den Fischzuchtbecken biologisch gereinigt wird, hinausgespült. Etwa ein Kubikmeter der rund einen Kubikzentimeter großen schwarzen Teilchen, die an Zahnräder erinnern, ging verloren - rund eine Million Stück. „Für die Umwelt besteht absolut keine Gefahr“, betonte Schmidt. Dennoch setze das Tropenhaus alles daran, in Kooperation mit Seepolizei, Berufsfischern sowie Behörden die Teile im Wasser und an Land einzusammeln. Ihn treffe, dass die Einrichtung in ihrem Selbstverständnis erschüttert sei: „Schließlich stehen wir dafür ein, umweltgerecht und nachhaltig zu produzieren.“ Um eine Wiederholung eines solchen Vorfalls zu verhindern, wurden zunächst die Gitter an der Anlage erhöht und soll der Überlauf verlegt werden. Jeder, der das Trägermedium finde und tütenweise abgebe, erhalte als Dank eine Eintrittskarte für das Tropenhaus.02.07.2010