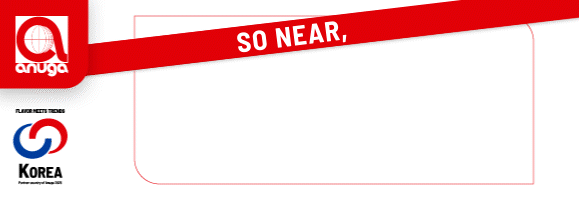24.08.2011
Krabbenfischer: „Einer der Großhändler geht über Leichen“
Die Krabbenfischer der deutschen Nordseeküste sind weiterhin unzufrieden mit den erzielten Preisen. „Die kleinste Sorte liegt nur noch bei 2,25 Euro pro Kilogramm“, zitiert die Nordsee-Zeitung den Präsidenten des Landesfischereiverbandes Weser-Ems, Dirk Sander. Ende Mai hatten die Fischer nach einem vierwöchigen Streik mit dem Handel einen Marktpreis von zunächst 2,50 Euro/Kilo ausgehandelt, der bis Anfang Juli auf kostendeckende 3,- Euro/Kilo steigen sollte. Der Durchschnittspreis habe jedoch seitdem nur bei 2,75 Euro gelegen, bevor er wieder sank, kritisiert Sander. Er befürchte daher, dass die ostfriesische Fangflotte weiter schrumpfen werde. „Zehn der 90 Schiffe werden bis ins nächste Jahr nicht überleben“, prognostiziert der Verbandsvertreter. „Der Handel will möglichst billig einkaufen, aber einer der Großhändler geht über Leichen,“ schimpft Dirk Sander. Hinzu kommt, dass in dieser Woche einige Fischer eine Fangpause einlegen müssen, weil in den Krabbenpulfabriken in Marokko aufgrund des islamischen Fastenmonats Ramadan nicht gearbeitet wird.24.08.2011
Lebensmittelpreise: Fisch war im Juli 4,4 Prozent teurer
Der Anstieg der Lebensmittelpreise in Deutschland hat sich im vergangenen Monat spürbar abgeschwächt, berichtet das Statistische Bundesamt. Im Juli 2011 hatten die Verbraucher für Nahrungsgüter im Schnitt 2,1 Prozent mehr zu zahlen als im entsprechenden Vorjahresmonat. Im Juni hatte das mittlere Plus noch 2,6 Prozent betragen. Die Preise für Fische und Fischwaren kletterten bezogen auf das Vorjahr um durchschnittlich 4,4 Prozent.24.08.2011
Island: Kein Finnwal-Fang in diesem Jahr
Island wird in diesem Jahr keine Finnwale fangen, obwohl das Land eine Quote für 150 Tiere besitzt, schreibt die Icelandic Review. Gunnlaugur Fjólar Gunnlaugsson, Direktor der Hvalurs Walverarbeitung in Hvalfjördur, begründete den Beschluss mit der Situation im Hauptmarkt Japan. Dort schreite der Wiederaufbau nach dem Erdbeben und Tsunami im Frühjahr diesen Jahres nur langsam voran. Auch Walhandelsunternehmen hatten Schaden erlitten hatten. In der letztjährigen Saison hatte Island 148 Finnwale erlegt, in diesem Jahr wurden bislang nur 50 Minkwale gefischt.23.08.2011
Österreich: 250 Gramm aus Binnenfischerei
Österreichs Landwirtschaftsminister Nikolaus Berlakovich empfiehlt seinen Landsleuten, „auf Produkte der nachhaltigen Binnenfischerei zu setzen“, um „schon heute etwas gegen die Überfischung zu tun“, meldet das österreichische Lebensministerium. „Für hervorragende Qualität aus der Heimat stehen etwa unsere acht Fisch-Genuss-Regionen“, unterstreicht der Minister. Zu den heimischen Fischprodukten zählen der Waldviertler Karpfen, die Ybbstal-Forelle und die Mattigtal-Forelle aus Oberösterreich, der Kärtna Laxn (Kärnten), das Salzkammergut-Reinanken - ein Felchen - (Oberösterreich und Salzburg), der Ausseerland-Seesaibling und die Steirischen Teichland-Karpfen jeweils aus der Steiermark sowie die Neusiedlersee-Fische (Burgenland). Die Agrarmarkt Austria plant, das AMA-Gütesiegel-Programm auf österreichischen Fisch auszuweiten. Derzeit werden in Österreich jährlich rund 4.000 Tonnen Fisch produziert, vor allem Regenbogen- und Bachforellen, Saiblinge, Karpfen, Reinanken, Hechte und Zander. Bei einer Wohnbevölkerung von 8,4 Millionen sind das 476 Gramm Fanggewicht oder etwa 250 Gramm Verzehrgewicht pro Kopf. Bei einem nationalen Fischkonsum von jährlich circa 65.000 Tonnen stammen 6,2 Prozent aus heimischer Erzeugung. Die Produktion steigt und es sei noch jede Menge Ausbaupotential vorhanden, heißt es aus dem Lebensministerium.23.08.2011
China: Ölkatastrophe vernichtet Jakobsmuscheln für 16 Mio. Euro
Eine Ölpest im Norden des Gelben Meeres hat die gefarmten Scallops an der nordchinesischen Küste in großem Umfang vernichtet, schreibt Fish Information & Services (FIS). Betroffene Fischer haben inzwischen einen Fonds über umgerechnet 325.000 Euro errichtet, um die Ölgesellschaften Conoco Phillips und die National Offshore Oil Corporation of China auf Schadensersatz zu verklagen. Schon am 4. Juni waren an zwei Ölplattformen Lecks entdeckt worden, doch erst am 13. Juli wurde dort die Produktion eingestellt. Die Ölpest betrifft vor allem die Bohai-Bucht. Den dortigen Fischern sollen ökonomische Verluste in Höhe von 16,3 bis 18,4 Mio. Euro (150 bis 170 Mio. Yuan) entstanden sein, schätzt der Präsident der Fischereivereinigung des Distriktes Laoting. Conoco Phillips hat jetzt mitgeteilt, die Bucht sei inzwischen zu 85 Prozent gereinigt worden. Allerdings würden weiterhin etwa 2.500 Barrel Öl auf dem Meeresboden liegen, die erst Ende August entfernt würden. Ein Barrel sind 158,99 Liter. Die Maßeinheit entspricht der Größe jener hölzernen Heringstonnen, die in den Anfängen der Erdölgewinnung Mitte des 19. Jahrhunderts gereinigt zum Abfüllen des Öls verwendet wurden.23.08.2011
USA: Schwarzfischer fischen Austern für 417.000 USD
In den USA sind sechs Austern-Diebe verhaftet worden, die in der Delaware-Bucht Austern im Wert von mehr als 417.000 Euro illegal gefischt haben sollen, meldet Fish Information & Services (FIS). Von 2004 bis 2007 sollen die Inhaber des Austern-Produzenten Reeves Brothers in Port Norris in Zusammenarbeit mit einem Miteigentümer des führenden Packhauses Harbor House Seafood teilweise doppelt soviel Austern gefischt haben, wie ihnen per Lizenz erlaubt war. US-Marschalls haben in diesem Kontext zehn Fangboote beschlagnahmt oder festgesetzt - ein erheblicher Teil der Austernflotte von New Jersey.23.08.2011
Berlin: Jeder vierte Angler wildert
Die Berliner Wasserschutzpolizei hat diesen Sommer sechs Wochen lang vermehrt Kontrollen zur Bekämpfung von Fischereidelikten durchgeführt, meldet die Berliner Umschau. Insgesamt kontrollierten die Polizisten vom 13. Juni bis 31. Juli 102 Angler. Dabei wurden 27 Strafanzeigen wegen Fischwilderei erstattet, 36 Angelruten wurden als Tatmittel beschlagnahmt, außerdem wurde eine Ordnungswidrigkeitsanzeige geschrieben. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf der Einhaltung der jeweils geltenden Auflagen, der tierschutzrechtlichen Bestimmungen sowie der umweltrechtlichen Vorschriften.22.08.2011
Sachsen: Fischdiebe stehlen 500 Kilo Forellen
Rund 1.000 bis 1.100 Forellen im Wert von 3.500 Euro wurden dem Forellenzüchter Jörg Schnek in der vergangenen Woche aus einer Hälterung gestohlen, schreibt SZ-Online. In der Nacht zu Dienstag, dem 16. August, fischten unbekannte Täter rund 500 Kilo Forellen aus einem Außenteich und transportieren die Fische in einem vermutlich großen Fahrzeug ab. Seit 1992 betreibt Schnek die Zucht inm sächsischen Limmnitz, etwa auf halber Strecke zwischen Leipzig und Dresden. Nachdem ihm vor zwei Jahren bei einer Serie von Diebstählen zweieinhalb Tonnen Lachsforellen und zwei Netze gestohlen worden waren, hatte der Züchter von der Kriminalpolizei Kameras anbringen lassen. Er selber installierte eine Warnanlage mit Infrarotlicht. In der Folge kam es zunächst zu keinen Straftaten mehr. Doch da immer wieder Nerze, Füchse und Fischreiher den Alarm auslösten, hatte Jörg Schnek die Signalhupe im Sommer abgeklemmt. Jetzt habe er sie wieder aktiviert: „Diese Nacht war ich um 2:30 Uhr draußen. Aber es war nur ein Fischreiher, der die Anlage ausgelöst hat.“22.08.2011
Homann schließt Rügen Feinkost-Werk in Rostock
Im Februar dieses Jahres hatte Homann die Rügen Feinkost übernommen, nun wird deren größtes Werk in Rostock geschlossen. Die Rügen Feinkost produzierte an den drei Standorten Saßnitz, Garz und Rostock mit insgesamt 240 Mitarbeitern insbesondere Heringsprodukte. Die Produktion in der Rostocker Werftstraße wird jetzt zum 31. August geschlossen, die dort 110 Mitarbeiter entlassen. Nachdem das Bundeskartellamt der Übernahme Mitte Juli zugestimmt hatte, gehörte der Feinkost-Produzent offiziell seit dem 1. August zur Homann-Gruppe. Bereits am nächsten Tag verkündete Homann-Geschäftsführer Martin Thörner das Aus für den Standort. Für das Werk gebe es im bestehenden Wettbewerbsumfeld „keine nachhaltige wirtschaftliche Überlebensfähigkeit“, begründete Thörner den Schritt. Die Marke werde jedoch weitergeführt, sagte Michael Scheibe, Pressesprecher der Düsseldorfer HK Food-Gruppe, zu der Homann gehört. Die Produktionskapazitäten würden nach Dissen verlagert, wo jedoch keine neuen Arbeitsplätze entstünden, heißt es in der in Bielefeld erscheinenden Neuen Westfälischen Zeitung. Dort arbeiten gut 800 Mitarbeiter in der Produktion und rund 200 in der Verwaltung.19.08.2011
Polen: Händler baut Lachsproduktion für 10 Mio. Euro
Das polnische Unternehmen Limito, ursprünglich ein reiner Seafood-Trader, baut derzeit eine Lachsproduktion für 10 Mio. Euro. Die Fabrik in Grudzidz (ehemals Graudenz), 117 Kilometer südlich von Danzig, soll schon im Januar 2012 den Betrieb aufnehmen, schreibt das Portal IntraFish. Die jährliche Kapazität werde auf 20.000 Tonnen Rohware oder 10.000 Tonnen Fertigprodukte ausgelegt. Möglich ist die Investition, da das holländische Private Equity-Unternehmen Avallon MBO im März bei dem Händler eingestiegen ist.- Schottland
- Lachszucht
- Antibiotika
- Chile
- Norwegen
- Sterblichkeit
- Überlebensrate
- VSV
- Vinnslustö∂in
- Leo Seafood
- Island
- Grundfisch
- Westmänner-Inseln
- Bremerhaven
- Dänemark
- Engelsviken Canning ...
- Engelsviken
- Kyokuyo
- Japan
- Shrimps
- Kocaman Balikcilik ...
- Clear Ocean ...
- Northseafood Holland
- Ocean’s ...
- Fischwirtschaftsgipfel
- FiWiGi
- Werner Lauß