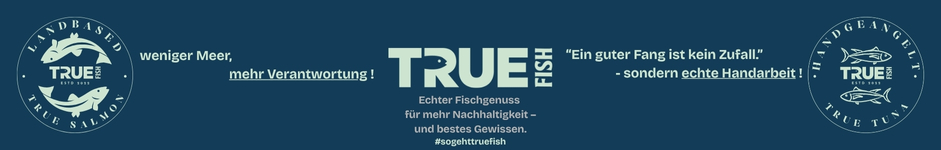09.05.2014
Ulm: Andreas Heilbronner übernimmt Traditions-Fischhaus
Das Fischhaus Heilbronner in Ulm (Baden-Württemberg) blickt auf eine mehr als 600 Jahre alte Unternehmensgeschichte zurück. Diese wird jetzt eine weitere Generation fortführen: Andreas Heilbronner (29) hat das Fischgeschäft und -restaurant, das seit dem Zweiten Weltkrieg in der Rebengasse 8 ansässig ist, von seinem Vater Eugen Heilbronner (59) übernommen. Aus dem Jahre 1392 datiert das älteste Schriftstück, das die Fischerfamilie Heilbronner erwähnt - "eine Art Lieferschein", berichtet der Junior der in Ulm erscheinenden Südwest Presse. Er selber habe "schon mit zehn Jahren […] samstags immer an der Kasse stehen und kassieren wollen", erinnert er sich. Im elterlichen Geschäft hat Andreas Heilbronner Einzelhandelskaufmann gelernt und jetzt für die Betriebsübernahme eine Ausbildereignungsprüfung angeschlossen. Zu dem Geschäft, einem unter Denkmalschutz stehenden Ensemble von drei Gebäuden, gehören Laden und Restaurant. Täglich von Dienstag bis Freitag werde frischer Fisch geliefert, die Feinkost - Salate, Remouladen, Dips - werden zu 80 Prozent im Hause produziert. Unterstützung erhält der Inhaber von seinem drei Jahre jüngeren Bruder Florian und der Mutter Edeltraud. Auch die kommende Generation haben Andreas Heilbronner und seine Frau Tina, die morgen heiraten, im Blick, schreibt die SWP: im September erwarte das Paar Nachwuchs.09.05.2014
Frankreich: Heringsfischerei in Ärmelkanal und Nordsee startet MSC-Verfahren
Die französische Heringsfischerei im östlichen Ärmelkanal und in der Nordsee bewirbt sich mit Unterstützung der Produzentenvereinigung FROM Nord um eine Zertifizierung nach den Standards des Marine Stewardship Councils (MSC). Verläuft die Bewertung erfolgreich, wäre es die insgesamt 14. Fischerei auf den atlanto-skandischen Hering, die MSC-zertifiziert ist. Ein Management-Komitee der FROM Nord teilt auch den beteiligten sieben Schwarmfisch-Trawlern aus den Häfen Boulogne sur Mer und Fécamp - alle zwischen 18 und 25 Metern lang - ihre Fangquoten zu. Die Boote fischen von der Landspitze bei Cherbourg im Süden bis zur holländischen Grenze im Norden und landeten 2013 insgesamt 5.618 t Hering an. Dieser wird überwiegend filetiert, für Konserven verwendet oder gesalzen, ein Teil auch frisch gehandelt. Der seit gut einem Jahrtausend befischte Heringsbestand in der Region war in den 1970er und 1990er Jahren unter Druck. Edouard Le Bart, MSC-Manager für Frankreich, hofft jedoch, dass die jetzt von dem Zertifizierer MacAllister Elliott und Partner durchgeführte Bewertung bestätigen werde, dass sich der Bestand erholt hat und dass die Fischerei unter Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit verwaltet wird.03.05.2014
Handelshof und Fischhandelskontor nutzen MSC-Gruppenzertifizierung
Bei der Handeshof-Gruppe Köln und dem Fischhandelskontor Thorsten Kuhirt können Kunden ab sofort Frischfisch aus nachhaltiger Fischerei mit MSC-Siegel kaufen, teilt der Marine Stewardship Council (MSC) mit. Die Handelshof-Gruppe betreibt 14 zertifizierte Cash & Carry-Märkte in Nordrhein-Westfalen (NRW), Mecklenburg-Vorpommern und im Großraum Hamburg. Die Märkte richten sich mit ihrem Sortiment an Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und Handel. Das Fischhandelskontor Kuhirt (Haan/NRW) beliefert in den Nacht- und frühen Morgenstunden den ambulanten und stationären Fischfachhandel, den LEH und GV-Einrichtungen in NRW. Handelshof und Fischhandelkontor sind die ersten Unternehmen in Deutschland, die im Rahmen des Modells eines externen Gruppenmanagers MSC-zertifiziert wurden. Die Gruppenzertifizierung empfiehlt sich für Firmen oder Standorte, die gemeinsam an der MSC-Zertifizierung arbeiten können und wollen. Da die Kosten für die Zertifizierung auf die Gruppenmitglieder aufgeteilt werden, sei der finanzielle Aufwand geringer, erklärt Kees Roorda, Mitarbeiter beim Gruppenmanager De & D Consult.02.05.2014
Rückläufige Preise für Ostseehering
Ende April wurden die letzten fünf Tonnen Hering aus der zurückliegenden Frühjahrsheringssaison in Mukran/Rügen angelandet. Die Küstenfischer an der Ostseeküste waren mit der Saison nicht ganz zufrieden. Neben einer Quotenkürzung von 23 Prozent bekamen sie auch noch weniger Geld als im Vorjahr. Insgesamt wurden 5.450 Tonnen Heringe vom Fischverarbeitungswerk Euro-Baltic aufgekauft und verarbeitet. Das sind 50 Prozent der gesamtdeutschen Heringsquote für die westliche Ostsee. Uwe Richter, Geschäftsführer von Euro-Baltic, zeigt sich mit der abgelaufenen Saison zufrieden: „Die Rogenqualität und die Qualität der angelandeten Heringe waren ausgezeichnet. Die Anlandungen konnten im Fischverarbeitungswerk komplett zu den verschiedensten Produkten verarbeitet werden.“ Die Erlöse für die Fischer waren in diesem Jahr niedriger. Hierfür verantwortlich sind die Absatzschwierigkeiten für den Ostseehering aufgrund des fehlenden MSC-Zertifikats. Allerdings sind die Preise nicht so stark gefallen, wie noch vor der Heringssaison befürchtet. Die Stellnetzfischer bekamen ab dem 12. März, als der Rogen reif war, 45 Cent für ein Kilogramm Hering. In der Schleppnetz- und Reusenfischerei waren es durchschnittlich 30 Cent. Das bedeutet für die Stellnetzfischer einen Rückgang von 13,5 Prozent und für die Schleppnetz- und Reusenfischer von 28 Prozent.29.04.2014
Belgien: Pittman investiert 2 Mio. Euro in Kapazitätsverdoppelung
Pittman Seafoods, belgischer Produzent von TK-Fisch und -Seafood, investiert 2 Mio. Euro, um die Kapazität seiner Verarbeitung in Zeebrugge zu verdoppeln, meldet das Portal IntraFish. Kern der technischen Neuerungen sei eine neue vollautomatische Schneidelinie für 600.000 Euro, teilt Geschäftsführerin Yoke Vandepitte mit, Tochter von Unternehmensgründer und Inhaber Dirk Vandepitte. Die Maschine des Herstellers Nienstedt kann 70 unterschiedliche Schnitte für Produkte mit einem Gewicht zwischen 6 und 400g leisten. Die Linie wird ein breites Fischarten-Spektrum verarbeiten, darunter Alaska-Seelachs, Farm- und Wildlachs, Kabeljau, Seelachs, Hoki, Seehecht und Pangasius. Neben zahlreichen Naturfilets und Filetportionen bietet Pittman auch Krebsfleisch und Ultra High Pressure (UHP)-Hummer an. Im Zusammenhang mit der Produktionserweiterung werde auch zusätzlicher Büroraum geschaffen.29.04.2014
Vietnam: Niederländer bauen Futterfabriken
Der holländische Futtermittel-Hersteller De Heus weitet seine R&D-Einrichtungen in Vietnam aus und baut außerdem zwei neue Futterfabriken in dem asiatischen Land, meldet das Portal IntraFish. Damit reagiere die De Heus-Gruppe auch auf die insbesondere in Europa und den USA bestehenden Bedenken hinsichtlich "der Qualität und des ökologischen Profils des vietnamesischen Aquakultur-Produktionsprozesses", begründete Marketing-Managerin Amy My den Schritt. Die im Februar 2015 in der Provinz Vinh Phuc 50 km von Hanoi in Betrieb gehende Fabrik (Kapazität: 250.000 t) werde unter anderem auch Fischfutter produzieren. Eine kleinere Produktion (70.000 t) soll 2015 in Binh Dinh starten.25.04.2014
Lachs-Aktien: Bis zu 20 Prozent Zuwachs in den kommenden sechs Monaten
Eine aktuelle Kaufempfehlung für Lachs-Aktien gibt Georg Liasjo, Analyst bei der norwegischen Investmentbank ABG Sundal Collier. In den nächsten sechs Monaten sollen die Effekten um 15 bis 20 Prozent wachsen, da die Branche als attraktiv eingestuft werde und die Entwicklung 2015 inzwischen absehbar sei, schreibt das Portal IntraFish. Angesichts eines für 2015 prognostizierten Wachstums von nur 3 Prozent erwarte Liasjo eine Aufwärtsbewegung beim Lachspreis sowie bei den Unternehmensgewinnen und -aktien. Insofern gebe ABG eine Kaufempfehlung für sämtliche Lachswerte, bis auf Grieg Seafood, die eine Halteempfehlung bekommt. Top-Empfehlung des Bankers sei inzwischen Marine Harvest, die noch vor drei Monaten auf dem vorletzten Platz der Empfehlungen gelegen hatte. Als Lachspreis-Prognose gibt ABG für 2014 unverändert 4,90 Euro/kg an und 4,60 Euro/kg für das Jahr 2015. Als sichersten Indikator für die norwegische Produktion verwendet die Bank die Verkaufsmengen von Lachsimpfstoff. Nachdem der Impfstoffabsatz 2011 um 27 Prozent gestiegen war, folgte 2012 ein Wachstum der Lachsliefermenge um 18 Prozent mit einem anschließenden Preisverfall. In den vergangenen zwölf Monaten hingegen stieg der Impfstoffabsatz um nur 1 Prozent. Außerdem seien in Chile im selben Zeitraum 5 Prozent weniger Smolts besetzt worden. Gleichzeitig bleibe die Lachsnachfrage angesichts einer wachsenden Mittelklasse in den aufstrebenden Ländern global stark.25.04.2014
Baden-Württemberg: 98 Prozent der Aquakultur sind Forellenartige
Im Jahre 2013 erzeugten die baden-württembergischen Aquakulturbetriebe insgesamt 3.450 t Speisefische, teilt das Statistische Landesamt auf Grundlage der letzten Aquakulturerhebung mit. Gegenüber dem Vorjahr wurde die Produktionsmenge von 3.200 t um gut 8 Prozent oder 250 t gesteigert. Nicht enthalten sind hierin die Fänge aus der Fluss- und Seenfischerei. Der Schwerpunkt der Erzeugung liegt mit 2.700 t auf der Regenbogenforelle. Rechnet man Lachsforelle, Bachforelle, See- und Bachsaibling sowie den Elsässer Saibling (eine Kreuzung aus Bach- und Seesaibling) hinzu, so machen die Forellenartigen mit 3.370 t knapp 98 Prozent der im Südwesten erzeugten Aquakulturfische aus. Karpfen ist in der Region mit einer Jahreserzeugung 2013 von 31 t nur eine Randerscheinung. Die Aquakulturerhebung wurde 2012 erstmals und jetzt zum dritten Mal durchgeführt.25.04.2014
Österreich: Garant investiert zwei Millionen Euro in Fischfutteranlage
Die Garant Tiernahrung, Österreichs einziger Fischfutterproduzent, hat ihre Fischfutteranlage im oberösterreichischen Aschach an der Donau mit einer Investition von über zwei Millionen Euro rundum erneuert. Die neue Produktionslinie besteht aus Mühle, Mischer, Extruder, Kühler, Trockner und Vakuumcoater. "Wir wurden zu diesem Schritt durch unsere Kunden in Österreich und den Exporterfolg ermutigt", sagt Garant-Geschäftsführer Christoph Henöckl. Der österreichische Markt mit einer heimischen Fischproduktion von 3.100 Tonnen sei zwar wichtig, diese alleine würde die Investition jedoch nicht rechtfertigen. Unter dem Namen Aqua Garant, der Fischfuttermarke der Garant Tiernahrung, werde ein umfangreiches Programm an nachhaltigem Fischfutter für Forellen und Karpfen angeboten. Das Futter zeichne sich durch eine umwelt- und ressourcenschonende Produktion aus, erklärt Henöckl. Um die nachhaltige Produktion von Fischfutter zu optimieren, hat Garant mit dem Wasser-Cluster Lunz ein Forschungsprojekt unter der wissenschaftlichen Leitung von Dr. Martin Kainz gestartet. Dabei solle marines Fischöl und Fischmehl teilweise durch regionale Rohstoffe wie etwa Rapsöl ersetzt werden. Fisch-Spezialist bei Garant ist Gerhard Hrastinger.24.04.2014