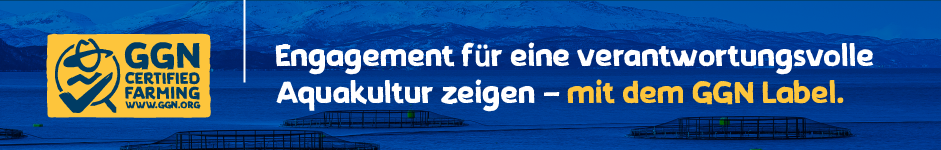07.06.2013
Nissui verkauft sämtliche TST-Anteile an Pacific Andes-Konsortium
Der japanische Konzern Nippon Suisan Kaisha (Nissui) hat seine sämtlichen Anteile an der TST-Muttergesellschaft Leuchtturm Beteiligungs- und Holding Deutschland AG an ein Investorenkonsortium unter Führung von Pacific Andes verkauft, meldet Nissui. Die Investorengruppe um die chinesische Pacific Andes wiederum ist Eigentümer von Pickenpack Europe, die in Lüneburg TK-Fischprodukte produziert. Erst Anfang 2012 waren die Japaner gemeinsam mit dem Partner Beacon Holding bei The Seafood Traders (TST) eingestiegen. Die neue Produktion von TST im ostfriesischen Riepe litt jedoch insbesondere unter dem losgetretenen harten Wettbewerb im umkämpften Markt für TK-Fisch und notierte unerwartet hohe Verluste. Nach eingehenden Überlegungen und Verhandlungen mit Pacific Andes entschloss sich Nissui zum Verkauf sämtlicher Leuchtturm-Anteile an die Chinesen, da die Geschäftsführung "der finanziellen Gesundheit der Gruppe Priorität einräumen wollte", schreibt Nissui. Der Verkauf ist noch abhängig von der Zustimmung der deutschen Kartellaufsichtsbehörde.07.06.2013
Royal Greenland: Will Fabrik in Wilhelmshaven verkaufen
Der TK-Produzent Royal Greenland hat eine Absichtserklärung mit zwei in Singapur ansässigen Investmentunternehmen unterzeichnet, seine Fischfabrik in Wilhelmshaven zu verkaufen, meldet das Portal IntraFish. Dort produziert Royal Greenland TK-Fertigprodukte insbesondere aus Alaska-Seelachs und Seehecht - zuletzt wurden 58.400 Tonnen (2012) verarbeitet. In Wilhelmshaven sind mehr als 400 Mitarbeiter beschäftigt. Der Verkauf erstreckt sich nicht auf die Aktivitäten der Gruppe in Cuxhaven, wo insbesondere 'Deutscher Kaviar' produziert wird. Der Abschied von Wilhelmshaven sei Teil einer Unternehmensstrategie, die die Konzentration auf jene Kerngeschäfte vorsehe, bei denen Royal Greenland die komplette Wertschöpfungskette vom Fang über die Verarbeitung bis zum Verkauf kontrolliere, heißt es in einer Stellungnahme. Dies sei das so genannte Nordatlantik-Geschäft. Denn nur bei kompletter vertikaler Integration könne man auf lange Sicht Geld verdienen, erklärte Royal Greenland-CEO Mikael Thinghuus gegenüber dem Portal Undercurrent News. Nicht zum Verkauf stehe die Royal Greenland-Fabrik im polnischen Koszalin, wo vor allem Plattfisch, Ostseefisch sowie einige grönländische Produkte verarbeitet werden. Der Käufer der Fabrik soll ein Investor aus Russland sein, der sich seit über 18 Jahren mit der Fischerei und der Verarbeitung von Seelachs und Hering beschäftige.07.06.2013
Cuxhaven: Lysell verlegt Produktion nach Sassnitz und Rostock
Bereits zum 30. Juni dieses Jahres will die Rügen Fisch AG die Produktion des Cuxhavener Traditionsunternehmens Lysell in der Seestadt schließen und nach Sassnitz auf Rügen sowie Rostock verlegen. Lediglich die Marinierung von Heringen soll vorerst mit fünf Beschäftigten bestehen bleiben, heißt es in einer Pressemitteilung der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten. Damit gehen in der Cuxhavener Fischindustrie weitere 109 Arbeitsplätze verloren. Rügen Fisch hatte das Lysell-Werk im April 2011 gekauft. Nach der Übernahme hegte die Belegschaft die begründete Hoffnung, dass der Betrieb in eine gesicherte Zukunft gehe, sagt NGG-Sekretär Christian Wechselbaum. Erste Schließungsgerüchte im November vergangenen Jahres hatte der Vorstandsvorsitzende von Rügen Fisch, Klaus Peper, damals gegenüber den Cuxhavener Nachrichten dementiert: "Da wird nichts geschlossen. Auch an eine Verlagerung der Produktion ist nicht gedacht." Jetzt wurde die Belegschaft kurzfristig in einer Versammlung über die Entscheidung des Konzerns informiert. Dem Betriebsrat und der Gewerkschaft NGG wurden Eckpunkte für einen möglichen Sozialplan vorgelegt. Bei Lysell gebe es fast nur Langzeitbeschäftigte, die ihr halbes Leben im Unternehmen verbracht haben, schreibt Wechselbaum.04.06.2013
Bremerhaven: Warnstreik bei Frozen Fish International
Mehr als 400 Beschäftigte von Frozen Fish International (FFI) in Bremerhaven sind heute Mittag einem Streikaufruf der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) gefolgt, teilt die NGG mit. Mit der dreistündigen Arbeitsniederlegung von 12:30 bis 15:30 Uhr sollte Druck auf die laufenden Tarifverhandlungen für die Fischwirtschaft in Bremerhaven und Cuxhaven ausgeübt werden, teilt NGG-Sekretär Christian Wechselbaum mit: "Wir fordern eine Erhöhung der Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen um 6,5 Prozent. Die Arbeitgeber haben jedoch nur ein Dumping-Angebot von einem Prozent für zwölf Monate vorgelegt, was für uns nicht verhandlungsfähig ist." Nach einer Kundgebung vor dem Betrieb von FFI zogen die Streikenden durch den Fischereihafen und hielten Kurzkundgebungen vor den ehemals von dem Tarifkonflikt betroffenen Betrieben Doggerbank (Parlevliet-Gruppe) und Louis Schoppenhauer. Frozen Fish International gehört zur Birds Eye Iglo-Gruppe und beschäftigt in Bremerhaven rund 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.03.06.2013
Mecklenburg: Potentielle Aquakultur-Standorte für Seenplatte benannt
Zur Entwicklung der Aquakultur in Mecklenburg-Vorpommern hat das Landwirtschaftsministerium für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte als ersten der sechs Landkreise im Nordosten potentielle Standorte für Aquakulturanlagen ermitteln lassen. "Heraus kamen 20 ausgewählte Standorte in 15 Kommunen mit Flächen zwischen 0,74 und 127 Hektar, die zum Teil über ungenutzte Wärmequellen in der Nachbarschaft, interessierte Partnerunternehmen, Teiche, Gebäude oder andere Nutzungsmöglichkeiten verfügen", berichtet Landwirtschaftsminister Dr. Till Backhaus, "alle genannten Kommunen stehen der Aquakultur aufgeschlossen gegenüber und sind an Investitionen interessiert." Über das Unternehmen MV-Invest und die regionalen Wirtschaftsfördergesellschaften biete das Land darüberhinaus Möglichkeiten der intensiven Begleitung von Investoren, sagt der Minister. Mit dem Institut für Fischerei der Landesforschungsanstalt, dem Fachbereich Aquakultur der Universität Rostock, dem Leibniz-Institut für Nutztierbiologie und der Bundesforschungsanstalt für Tiergesundheit verfüge Mecklenburg-Vorpommern außerdem über eine der besten Forschungsinfrastrukturen im Bereich der Aquakultur in Deutschland. Den kompletten Bericht finden Interessenten unter: service.mvnet.de/_php/download.php?datei_id=83737.31.05.2013
Neuenburg: Abrahams wird "kulinarischer Botschafter" für Niedersachsen
Die Lachsräucherei Abrahams wird "kulinarischer Botschafter Niedersachsens", meldet die Nordwest-Zeitung. Wenn am kommenden Montag, dem 3. Juni, in Hannover Niedersachsens Top-100 Lebensmittel ausgezeichnet werden, ist dabei auch das Produkt 'Sockeye Wildlachs' von Abrahams Fisch Feinkost aus dem ostfriesischen Neuenburg. "Wir haben uns das erste Mal beworben und sind selbstverständlich stolz darauf", sagt Vertriebsleiter Stephan Geitz. Einmal im Jahr ordert Abrahams den kanadischen Wildlachs im Ursprung. Im vergangenen Jahr seien es 40 Container mit 22 Tonnen gewesen, also fast 900 Tonnen. Geräuchert und verarbeitet wird der Wildlachs auf einer Produktionsfläche von inzwischen 3.700 Quadratmetern im Gewerbegebiet Collstede. Seit 1995 ist der Standort ständig erweitert worden, zuletzt um eine neue Kühlanlage für fast 300.000 Euro. Das Gros der verarbeiteten Rohware - etwa 70 Prozent von jährlich 2.900 Tonnen - sei jedoch norwegischer Zuchtlachs, sagt Prokurist Wilfried Wehrmann. Mit Lachs werden 80 bis 90 Prozent des Jahresumsatzes von zuletzt rund 23 Mio. Euro (2012) erwirtschaftet. Abrahams sei stolz darauf, in Deutschland zu produzieren. Künftig solle das durch einen klaren Schriftzug auf der Ware "Hergestellt in Deutschland" ausgelobt werden, kündigt Stephan Geitz an.30.05.2013
Matjes: Saisoneröffnung auf den 19. Juni verschoben
Der bundesweite Start der diesjährigen Matjessaison ist auf den 19. Juni verlegt worden. Das gab die Niederländische Vereinigung des Heringsgroßhandels und des Fischfachhandels gestern bekannt. Der Grund für die Verschiebung um zwei Wochen: der jetzt gefangene Hering hat wegen der schlechten Witterung der letzten Wochen zu wenig Nahrung gefunden. Deshalb fehlt ihm die richtige Qualität, um zu holländischem Matjes verarbeitet zu werden. Denn nur aus einem Hering mit dem richtigen Fettanteil kann ein guter Matjes werden. Die Versteigerung des ersten Matjes-Fässchens in Bremen wird daher nicht wie ursprünglich geplant am 5. Juni stattfinden, sondern am Mittwoch, dem 19. Juni - zeitgleich mit der traditionellen Auktion im niederländischen Scheveningen. Nach 2006 ist es das zweite Mal in der Geschichte, dass die Matjes-Saisoneröffnung nicht zum geplanten Termin stattfinden kann. Doch Nico de Jong, Vorsitzender der Großhandelsvereinigung, steht zu der Entscheidung: "Die Saison mit einem Matjes minderer Qualität zu beginnen ist keine Option. Wir möchten dem Konsumenten ein Spitzenprodukt anbieten, so wie er es seit jeher gewohnt ist."29.05.2013
Polen: Neuer Lachsverarbeiter Limito setzt auf "große LEH-Kontrakte"
Ambitionierte Ziele hat sich die neue Lachsproduktion des polnischen Unternehmens Limito gesetzt. "Wir streben bei Lachs die Führung an", zitiert das Portal IntraFish Fabrikdirektor Krzysztof Kleinschmidt. Im März 2012 hatte die für rund 10 Mio. Euro errichtete Produktion im polnischen Grudziadz (dt. Graudenz) den Betrieb aufgenommen, ein halbes Jahr später wurde sie in Anwesenheit von 200 Gästen - darunter als Redner auch Polens früherer Staatspräsident Lech Walesa (69) - offiziell eingeweiht. Auf drei Produktionslinien laufen geräucherte, frische und gefrorene Lachsprodukte. 300 Mitarbeiter werden ständig beschäftigt, zur Hochsaison werde die Belegschaft auf bis zu 400 aufgestockt, sagt Kleinschmidt. Zur Kundschaft zählten führende LEH-Filialisten, aber auch einige Foodservice-Unternehmen, auf dem heimischen polnischen Markt, in Ost- und Westeuropa sowie in Australien. Kleinschmidt: "Wir bevorzugen große LEH-Kontrakte." Der Umsatz lag im vergangenen Jahr im Bereich zwischen 30 und 35 Mio. Euro, für dieses Jahr strebe Limito 50 Mio. Euro an. Allerdings leide die Marge - wie bei manchem Wettbewerber - unter den seit geraumer Zeit hohen Preisen für die norwegische Rohware. In puncto Profitabilität sei das erste Quartal 2013 daher "nicht das beste" gewesen, formuliert der Direktor euphemistisch.28.05.2013
Spanien: Pescanova muss 2,4 Milliarden Euro Schulden abbauen
Der multinationale spanische Fischereikonzern Pescanova muss Schulden in Höhe von 2,4 Mrd. Euro tilgen, um lebensfähig zu bleiben. Das berichtet die spanische Tageszeitung "El Confidencial" unter Berufung auf Gläubigerbanken, schreibt wiederum IntraFish. Die Summe entspreche 80 Prozent der Gesamtverschuldung von etwa 3 Mrd. Euro, wobei hierin die Verpflichtungen gegenüber Anleihegläubigern noch nicht berücksichtigt seien. Als einzig realisierbare Lösung böte sich eine Umwandlung der Bankkredite in Beteiligungskapital an, schlagen die Inhaber der Wertpapiere vor. Selbst nachdem Pescanova eine Notfinanzierung in Höhe von 55 Mio. Euro erhalten hatte, sei das EBITDA weiterhin zu niedrig. So würde das EBITDA für 2012 in Höhe von 140 Mio. Euro nicht ausreichen, um den jährlichen Schuldendienst von gut 150 Mio. Euro zu bedienen.28.05.2013
Konserven-Hersteller warnen vor Freihandelsabkommen mit Thailand
Die Fischkonserven-Industrie in Spanien, Portugal und auf den Azoren hat Bedenken geäußert bezüglich eines seit März zwischen der Europäischen Union und Thailand verhandelten Freihandelsabkommens, schreibt Fish Information and Services (FIS). Portugal und Spanien produzierten im vergangenen Jahr rund 400.000 t Fischkonserven im Wert von 1.550 Mio. Euro, die Branche beschäftigt über 17.000 Menschen. Thailand wiederum ist der weltgrößte Hersteller und Exporteur von Fischkonserven. Daher fürchten die iberischen Industrieverbände Anfaco, ANICP und Pao do Mar den Wettbewerb insbesondere bei Thunfischkonserven: Portugal und Spanien stehen für 75 Prozent der EU-Produktion von Thunfisch in Dosen, Thailand wiederum ist global der größte Exporteur dieser Produkte. Aufgrund niedriger Produktionskosten in Thailand, insbesondere aufgrund des dort billigen Faktors Arbeit, langer täglicher Arbeitszeiten und fehlender sozialer Absicherung, fordern die drei genannten Organisationen, vor allem Thunfisch-Konserven von dem Freihandelsabkommen auszuschließen.- Chile
- Lachszucht
- Lachs
- organisierte Kriminalitä...
- Task-Force
- Puerto Montt
- Raubüberfä...
- Rodrigo Pinto
- SalmonChile
- Salmon Council
- Sernapesca
- Regal Springss ...
- Regal Springs
- Tilapia
- Buntbarsch
- Superior Taste ...
- Petra Weigl
- International Taste ...
- Fischfachhandel
- Berlin
- Rogacki
- Dietmar Rogacki
- KaDeWe
- Rollenhagen
- Nöthling
- Aschinger
- Antje Blum