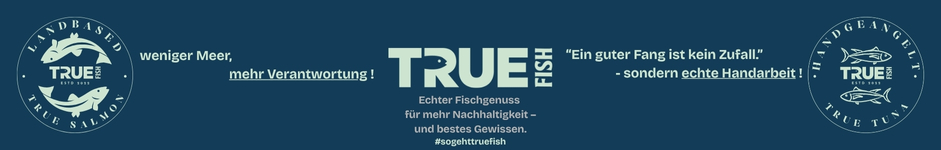02.10.2018
USA: Keine Strafzölle auf TK-Lachsfilets
Nach Alaska-Pollack hat die US-Regierung jetzt auch gefrorene Lachsfilets von dem seit dem 24. September 2018 geltenden Strafzoll in Höhe von 10% für Importe aus China ausgenommen, meldet das Portal IntraFish. Das teilte der Handelsbeauftragte der Vereinigten Staaten (USTR) am vergangenen Freitag mit. Die Neuregelung tritt rückwirkend zum 24. September in Kraft. Das Alaska Seafood Marketing Institute (ASMI) begrüßte die Änderung, denn: "Letztendlich bekommen nicht die Chinesen die zusätzlichen Zölle von 10 bis 25 Prozent auf Seafood-Produkte aus China zu spüren, sondern amerikanische Unternehmen, die Fischer von Alaska und die U.S.-Verbraucher." Garrett Evridge, Ökonom der McDowell-Gruppe in Alaska, meint, die Lachsexporte des Bundesstaates nach China seien erheblich bedeutender als jene von Alaska-Pollack: "Die zwei wichtigsten Exportgüter an Alaska-Seafood nach China sind pazifischer Kabeljau und Lachs. Wir schicken nicht viel Pollack nach China.“ Entsprechend sei die spontane Freude bei Alaskas Seafood-Industrie jetzt größer gewesen als jene beim Streichen des Alaska-Pollack von der Liste.02.10.2018
Schottland: Loch Duart notiert Gewinnrückgang
Der schottische Lachsproduzent Loch Duart meldet für das Ende März abgeschlossene Geschäftsjahr 2017/18 einen Gewinnrückgang von 58%, schreibt IntraFish. Insbesondere eine Kiemenerkrankung im Lachsbestand sei dafür verantwortlich gewesen, dass der Betriebsgewinn gegenüber 9,9 Mio. Euro im vorangegangenen Geschäftsjahr zuletzt nur noch 4,2 Mio. Euro betrug. Der Umsatz lag bei 47,6 Mio. Euro. In einer Unternehmensmitteilung wird allerdings betont, dass das Vorjahresergebnis aufgrund außergewöhnlicher Umstände auch ein besonders erfolgreiches gewesen sei: "Das Jahr bis März 2018 bescherte ein Rentabilitätsniveau, das dem normalen, nachhaltigen Potentialbereich entsprach." In seinen schottischen Betrieben investiert Loch Duart weiterhin erheblich in Forschung und Entwicklung, nicht zuletzt, um mögliche Probleme in den Bereichen Umwelt und Fischgesundheit anzugehen. Für das kommende Jahr rechne die Geschäftsführung angesichts der produzierten Mengen mit einer profitablen Bilanz.02.10.2018
Rügen: Fisch- und Wollmarkt will traditionelles Handwerk erhalten
In Schaprode auf der Ostseeinsel Rügen (Mecklenburg-Vorpommern) fand am vergangenen Wochenende erstmals ein Fisch- und Wollmarkt statt. Der am Samstag und Sonntag veranstaltete Markt im Hafen des Ortes will das traditionelle Kulturgut der Küstenfischerei und der Schafhaltung auf Rügen und Hiddensee feiern und für deren Erhalt die Öffentlichkeit mobilisieren. Veranstalter ist der Verein der Hiddenseer Kutterfischer. Die Hiddenseer Stellnetz-Fischer verkaufen ihren Fang unter der Marke "Hiddenseer Kutterfisch" zum großen Teil an Ort und Stelle. Das vom örtlichen Landwirt und Gastronomen Mathias Schilling initiierte Projekt wird über das Bundes-Modellvorhaben Land(auf)Schwung gefördert und ist inzwischen zu einem Botschafter für das Rügener Fischerhandwerk geworden.01.10.2018
Frankreich: Fischerei auf Roten Thun startet MSC-Verfahren
Eine kleine handwerkliche französische Fischerei auf den Roten Thun (Thunnus thynnus) im östlichen Atlantik und im Mittelmeer will sich nach dem Standard des Marine Stewardship Councils (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifizieren lassen. Weltweit ist es erst die zweite Fischerei auf Roten Thun, die ins MSC-Programm einsteigt. Die Fangschiffe sind sämtlich unter 18 Meter lang und fischen in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) Frankreichs, insbesondere im Golf von Lion und nordwestlich von Korsika. Sie agieren unter dem Dach der Marke "Thon rouge de ligne - peche artisanale" - zu deutsch: "Roter Thun geangelt - handwerkliche Fischerei". Insgesamt werden im Fangzeitraum von April bis Dezember jährlich rund 200 t Roter Thun angelandet, der vor allem in der Region und dort insbesondere an gehobene Restaurants verkauft wird.25.09.2018
Wangerooge organisiert erstmals Miesmuscheltage
Die ostfriesische Insel Wangerooge organisiert vom morgigen Mittwoch, den 26. bis zum Sonnabend, den 29. September, die ersten Wangerooger Miesmuscheltage, meldet das Portal Emden1. Höhepunkt der viertägigen Veranstaltung wird der Sonnabend, an dem der Wangerooger Einzelhandel und die Kurverwaltung ein buntes Programm aus Kinderaktionen und Musikdarbietungen anbieten. Den ganzen Tag über wird es darüberhinaus Miesmuscheln in kleinen Portionen und in den unterschiedlichsten Varianten in den Wangerooger Betrieben und an einigen Verkaufsständen geben. Verbunden ist die Probiermeile mit einem Gewinnspiel. Zu Beginn holen sich die Besucher des Festes einen Miesmuschelpass ab und erhalten für jede Probierportion - ausgegeben in zwölf Restaurants und Geschäften - einen Stempel. Ist der Pass mit drei Portionen gefüllt, wandert er in eine Losbox. Um 20:45 Uhr werden Preise verlost, darunter Hotel-Übernachtungen, Fahrkarten für Schiffe und die Inselbahn, ein Thalasso-Paket und Restaurantgutscheine. Außerdem erhofft sich Wangerooge, über die große Zahl der verkauften Miesmuschelportionen einen Weltrekord aufzustellen.25.09.2018
Gosch eröffnet demnächst in Travemünde
Ein Lizenznehmer von Gosch Sylt wird im Dezember diesen Jahres ein Gosch-Restaurant im Ostseebad Travemünde eröffnen, meldet das Portal Travemünde Aktuell. Das ehemalige Restaurant "Fisherman" an der Kaiserbrücke des Ortes wurde von der Hamburger PS Betriebs GmbH/BTS GmbH gepachtet und soll nun für 1,2 Mio. Euro - so heißt es aus unbestätigter Quelle - weitgehend entkernt und neu eingerichtet werden. Die Investoren sollen seit gut zehn Jahren versucht haben, sich in Travemünde anzusiedeln. Währenddessen hat Gosch Sylt sein 27 Jahres altes Restaurant am Hamburger Hauptbahnhof nach einer zweieinhalb Monate dauernden Umbauphase am 2. September wiedereröffnet, schreibt die Allgemeine Hotel- und Gastronomie-Zeitung (AHGZ). Als "industriellen Hafenchic" bezeichnet der Autor das auf rustikale Holz- und Metallelemente setzende typische Gosch-Ambiente, das den Reisenden das Sylter Urlaubsgefühl vermitteln will. Dafür sorgt auch ein neues großes Panorama-Bild mit Sylter Strandmotiv. Der Umbau des Restaurants soll darüberhinaus den Mitarbeitern ein schnelleres Servieren der Gerichte ermöglichen. Das vor allem auf Fisch und Meeresfrüchte setzende Haus unter der Leitung von Christian Prigge hat insgesamt mehr als 80 Sitzplätze.25.09.2018
Chile: Invermar erhält erste ASC-Zertifizierung
Der chilenische Lachszüchter Invermar hat für eine erste Farm eine Zertifizierung des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) erhalten, melden die Undercurrent News. Die Lachsfarm "Traiguen 2" auf der Insel Quinchao (Región de los Lagos) im Süden Chiles ist gleichzeitig die erste Farm für Atlantischen Lachs, die im Chiloé-Archipel ein ASC-Zertifikat erhalten hat. Die Region gilt aus biologischer Sicht als "notorisch schwierig". Ende 2017 hatte Invermar durch eine Algenblüte rund 1.600 t Lachse verloren. Lag die Produktion 2017 bei 23.000 t, rechnet der Züchter für 2018 mit einer Ernte von 28.000 t. In der Farm sei die Gefahr eines Lachslausbefalls hoch, sagt Mario Pasten Soto, bei Invermar für Zertifizierungen zuständig. Denn der ASC-Standard verlangt eine Verringerung der Parasitenbekämpfung und eine Beschränkung des Antibiotika-Einsatzes auf drei Behandlungen während eines Produktionszyklus'. Pasten betont, dass geringere Besatzdichten der Zucht jedoch eine bessere Fischgesundheit, bessere Wasserqualität und Futterverwertung ermöglichen. Bis Ende dieses Jahres will Invermar für vier weitere Lachsfarmen eine ASC-Zertifizierung erreichen.25.09.2018
Hamburg: Lebensmittel-Manufaktur am Fleischgroßmarkt geplant
Der Fleischgroßmarkt Hamburg (FGH) will an der Sternschanze eine Lebensmittel-Manufaktur einrichten, in der auch Fischprodukte hergestellt werden sollen, meldet das Hamburger Abendblatt. "Wir denken an Fisch, Fleisch, Wurst, Patisserie, Eis und Bäckereien", erläutert FGH-Geschäftsführer Frank Seitz. Besucher des Großmarktes sollen die Zubereitung beobachten können. Möglich wird diese Manufaktur, weil der Großhandel Delta-Fleisch den Großmarkt verlässt und sich in Norderstedt ansiedelt. Das Unternehmen, das Gastronomie und Fachhandel mit mehr als 8.000 Lebensmitteln beliefert, stieß an der Lagerstraße an seine Kapazitätsgrenzen. Ein Abholmarkt und ein Bistro sollen jedoch bleiben. "Wenn Delta Ende des Jahres auszieht, wird eine rund 6.000 Quadratmeter große Halle frei", sagt Seitz und skizziert das geplante Objekt: "Hinten handgemacht produziert und nach vorne heraus verkauft." Die Produktion soll das Wichtigste sein, es werde keine Markthalle. Im Fleischgroßmarkt zwischen S-Bahnhof Sternschanze und Hamburger Messegelände arbeiten rund 4.000 Beschäftigte.24.09.2018
USA: Silver Bay baut neue Fabrik in Alaska
Silver Bay Seafoods errichtet in False Pass (Alaska) eine neue Fabrik, die neben Wildlachs auch Alaska-Pollack und Kabeljau verarbeiten soll, meldet IntraFish. In dem kleinen Ort an der Ostküste der Aleuten-Insel Unimak stehen schon Verarbeitungsbetriebe von Bering Pacific Seafoods (BPS), im Gemeinschaftsbesitz von Trident Seafoods und eines Kommunalverbands, sowie von Peter Pan Seafoods. Da die Lachs-Runs in der Region in den letzten Jahren stärker geworden seien, ist der Standort günstig. Die Produktion soll ganzjährig arbeiten. Silver Bay besitzt fünf weitere Betriebe. Erst 2016 hatte Silver Bay eine 6.500 qm große Fabrik in Valdez (Alaska) in eröffnet.24.09.2018