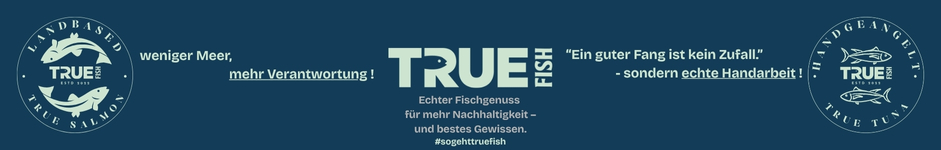05.06.2019
ASC-Futterstandard rückt der Vollendung näher
Der Futterstandard des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) ist seiner Verabschiedung ein Stück näher gerückt, nachdem das Steuerungskomitee im Mai eine generelle Einigung bezüglich der Struktur und des Inhalts des neuen Standards erzielt hatte, teilt der ASC mit. Das Komitee ist aus einer Stakeholder-Gruppe gebildet, zu der Vertreter der Futtermittelindustrie, der Futterzusatzstoffindustrie, der Farmbranche, von NGOs und Lebensmitteleinzelhandel gehören. Michiel Fransen, Leiter des ASC-Bereichs "Standards & Wissenschaft", erklärte, dass das Spektrum ökologischer und sozialer Bedenken bei pflanzlichen Inhaltsstoffen wie Soja, Weizen, Mais, Reis, Raps u.a. mindestens genauso komplex sei, wenn nicht sogar komplizierter als jenes bei marinen Inhaltsstoffen. Die Komplexität der Getreidelieferkette erschwere es, hier Nachhaltigkeitsaspekte zu thematisieren. Bei dem persönlichen Treffen wurde unter anderem festgelegt, dass eine Priorität die Rückverfolgbarkeit der Herkunft sei und die Forderung, das Getreide aus Anbaugebieten zu beziehen, in denen die Gefahr illegaler Abholzungen gering sei. Schon seien erste Testauditierungen nach dem Standard in Vorbereitung. Mit einer Verabschiedung des Futtermittel-Standards werde gegen Ende 2019 gerechnet.04.06.2019
Emder Matjes wird erneut "Kulinarischer Botschafter Niedersachsens 2019"
Bereits im vierten Jahr in Folge ist der Emder Matjesproduzent Fokken & Müller 2019 für einige seiner Matjesspezialitäten mit dem Label "Kulinarischer Botschafter Niedersachsen" ausgezeichnet worden. Am gestrigen Montag, den 3. Juni, überreichte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil der Emder Matjes- und Feinkostmanufaktur die Auszeichnung für ihre Emder Bismarckheringe, die Emder Sahnematjesfilets und erneut für die Emder Matjesfilets. Stellvertretend für das Team von Fokken & Müller nahm Sascha Weddermann, Mitglied der Geschäftsführung, den Preis entgegen. Bereits im Jahre 2016 hatte Weil dem Matjesproduzenten erstmals die Auszeichnung verliehen. Seitdem wurden acht Produkte aus Emden ausgezeichnet. Neben den Preisträgern von 2019 überzeugten bereits die Emder Rauchmatjes (2016, 2018), die Emder Matjesfilets (2017), Emder "Roter Matjessalat" (2018) und Emder Garnelen Bombay (2018) die Fachjury.04.06.2019
Köln: Konferenz zum Futter in der Aquakultur
In Köln findet am 12. Juni 2019 eine eintägige Konferenz zum Futter in der Aquakultur statt, die "12th Aquafeed Horizons". Rahmen für das Event ist die vom 12. bis 14. Juni laufende Victam International 2019, weltgrößte Fachmesse für die Herstellung und Verarbeitung von Tierfutter, die Getreideverarbeitung, Inhalts- und Zusatzstoffe, Aquafutter und Heimtiernahrung. Unter den rund 7.500 Besuchern stammten im Jahre 2015 gut 6,6% aus dem Hauptgeschäftsfeld Fisch- und Aquakulturfutter. Auf der "Aquafeed Horizons" werden ein gutes Dutzend Referenten Vorträge halten.04.06.2019
Bremerhaven: Ehemaliger Nordsee-Geschäftsführer M.-H. Rehder gestorben
Marx-Henning Rehder, langjähriger Geschäftsführer der Nordsee-Gruppe, ist Anfang Mai im Alter von 100 Jahren gestorben. Rehder war nach seinem Kriegsdienst im Sommer 1945 als Leichtmatrose zur "Nordsee" Deutsche Hochseefischerei gekommen. Seit 1960 leitete er als Geschäftsführer die damalige Reederei und wurde 1971 Vorsitzender der Geschäftsführung. "Unter ihm hat die Nordsee-Gruppe ihren größten Umfang erfahren", schreibt der "Nordsee-Freundeskreis von 1995" in einem Nachruf. Damals hatte die Gruppe rund 10.000 Beschäftigte in den Bereichen Reederei, Industrie und Handel. Von 1975 bis 1982 war Henning Rehder außerdem Präsident des Bundesmarktverbandes der Fischwirtschaft. Als Nordsee-Geschäftsführer trat er 1981 in den Ruhestand und wechselte in den Aufsichtsrat des Unternehmens. "Mit vorbildlichem Engagement und ausgeprägtem Verantwortungsgefühl war Henning Rehder über Jahrzehnte Steuermann unseres Unternehmens," schreiben Geschäftsführung und Betriebsrat der Nordsee in einem Nachruf.03.06.2019
Norwegen: Landgestützte Lachszucht besetzt erstmals
Frederikstad Seafoods, Tochterunternehmen von Nordic Aquafarms, hat für seine landgestützte Lachszucht in Fredrikstad die ersten 100.000 Smolts Besatzmaterial erhalten, meldet Fish Information & Services (FIS). "Wir rechnen damit, dass wir im Mai kommenden Jahres beginnen können, das Premium-Produkt zu verkaufen", kündigte Bernt Olav Røttingsnes an, CEO von Nordic Aquafarms. Bei Vollauslastung können die beiden Produktionsmodule der Farm jährlich 1.500 t Lachs (HOG) produzieren. Mit zwei etablierten Produktionen in Norwegen und Dänemark und zwei geplanten Projekten in den USA sei Nordic Aquafarms ein führender Akteur bei der landgestützten Aquakultur, sagte Røttingsnes.03.06.2019
Rostock: Feuer vernichtet Thai Union-Fischölfabrik
Ein Brand hat am vergangenen Sonnabend, den 1. Juni, die Fischöl-Produktion des Konzerns Thai Union in Rostock-Bentwisch völlig zerstört, meldet das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Als die Freiwillige Feuerwehr Bentwisch gegen kurz nach 8:00 Uhr morgens am Brandherd eintraf, brannte die Halle schon in voller Ausdehnung, teilte Kreisbrandmeister Mayk Tessin mit. Ingesamt hätten 13 Wehren mit insgesamt 130 Einsatzkräften versucht, das Gebäude von allen vier Seiten zu löschen. In der erst im November 2018 eröffneten Raffinerie sollten auf einer hochautomatischen Produktionslinie jährlich rund 5.000 t hochwertiges Thunfischöl für die Herstellung von Babynahrung produziert werden.03.06.2019
Schweden: Weltweit erstes Nahrungsergänzungsmittel mit ASC-/MSC-Zertifikat
In Schweden können die Verbraucher erstmals Omega 3-Kapseln kaufen, die sowohl ASC- als auch MSC-zertifiziert sind, meldet der Aquaculture Stewardship Council (ASC). Das Produkt "Omega-3 pure and natural'" von BioSalma enthält Fischöl von Fischen, die in Norwegen entweder nachhaltig gefischt oder nachhaltig gezüchtet wurden. Zwei Jahre lang habe BioSalma daran gearbeitet, seine gesamte Lieferkette zertifizieren zu lassen. Damit seien die Kapseln das weltweit erste Nahrungsergänzungsmittel, das beide Zertifizierungen trage. Erhältlich ist der Artikel über den Online-Versandhandel Apotea.se sowie in ausgewählten Filialen der Handelskette ICA. Bis Ende des Jahres will BioSalma für alle seine Omega-3-Produkte eine entsprechende Zertifizierung haben.31.05.2019
Homann schließt Feinkostwerk in Floh-Seligenthal
Der Feinkostanbieter Homann will sein Werk im südthüringischen Floh-Seligenthal (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) zum 31. August diesen Jahres schließen, meldet der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR). Betroffen sind 65 Beschäftigte. Ein Unternehmenssprecher teilte mit, im Zuge der Analyse zur Neuaufstellung der Salat-Sparte habe sich ergeben, dass sich der Standort "nicht dauerhaft wirtschaftlich sinnvoll weiterbetreiben lässt". Im März war bereits bekannt geworden, dass Homann, ein Teil der Unternehmensgruppe Theo Müller, sein Werk in Sassnitz auf Rügen mit 50 Mitarbeitern schließen will.31.05.2019
Dänemark: ICES empfiehlt für Nordseehering ein Plus von fast 40 Prozent
Der Internationale Rat für Meeresforschung (ICES) hat empfohlen, die Fangquote für den Nordseehering in der kommenden Saison 2020 um beinahe 40% anzuheben, meldet IntraFish. Insgesamt schlägt das in Kopenhagen ansässige Gremium eine Fangquote von 418.619 t für die direkte Fischerei vor, in toto 431.062 t, was im Vergleich zu 2019 einem Plus von 38,4% entspräche. Der Grund: der diesjährige Forschungsbericht hat eine Verbesserung der Biomasse-Situation festgestellt. Für das aktuelle Fangjahr hatte der ICES eine TAC von 291.040 t für die direkte Fischerei vorgeschlagen, ingesamt 311.572 t, wobei die vereinbarte Fangquote schließlich bei 385.008 t lag.31.05.2019