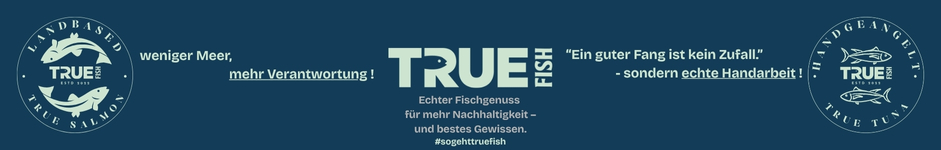04.02.2015
Larsen Danish Seafood: Zwei Kaufinteressenten
Für die Marke und die Fabriken des insolventen deutsch-dänischen Fischproduzenten Larsen Danish Seafood gibt es offenbar zwei Kaufinteressenten, schreiben die Undercurrent News. Die fischwirtschaftlichen Unternehmen, deren Namen ein Sprecher des Insolvenzverwalters Cornelius + Krage nicht nennen wollte, interessieren sich sowohl für die Produktionsbetriebe in Harrislee bei Flensburg und Leegina in Bremerhaven als auch für die mehr als 100 Jahre alte Traditionsmarke Larsen. Eine Entscheidung über die Zukunft von Larsen könnte noch im Februar fallen, spätestens jedoch zum Ende des ersten Quartals 2015, wie Insolvenzverwalter Wilhelm Salim Khan Durani angekündigt hatte. Die Undercurrent News spekulieren, wer die potentiellen Käufer sein könnten. Karavela, ein schnell wachsender Fischkonserven-Hersteller aus Lettland, hatte schon im November Interesse signalisiert, wollte sich aktuell aber nicht mehr äußern. Henrik Mikkelsen, Geschäftsführer des dänischen Konservenproduzenten Sæby Fiske-Industri, teilte mit, er verfolge zwar den Verkaufsprozess mit Interesse, biete jedoch selbst nicht. Möglich sei auch, dass ein asiatischer Gigant wie die Thai Union Frozen Products (TUF) über Larsen in den deutschen Markt einsteigen könnte. Die TUF hatte im September 2014 schon den französischen Lachsverarbeiter Meralliance übernommen und kurz darauf King Oscar, norwegischer Markenhersteller von Sardinen-Konserven.04.02.2015
Irland: Planktonblüte vernichtet große Teile der Muschelernte
Irlands Muschelzüchter erleben gegenwärtig eine desaströse Saison. Das warme Wetter im vergangenen Sommer führte zu einer späten und bis weit in den Herbst reichenden Blüte einer der bekanntesten und gefährlichsten Phytoplanktonarten, nämlich der giftigen Dinoflagellaten-Gattung Dinophysis, besser bekannt als Red Tide oder Rote Flut, schreibt der Irish Examiner. In einigen irischen Buchten, in denen Seilmuschelkulturen liegen, hat die Algenblüte in diesem Winter zu einer anhaltenden schweren Krise der Branche geführt. Richie Flynn, Vertreter der Irischen Landwirtevereinigung (IFA), Abt. Aquakultur, spricht von einem „totalen wirtschaftlichen Sturm“. Das Tragische: 2014 war im Hinblick auf das Wachstum und die Qualität der Muscheln zunächst derart gut, dass ein Rekordjahr prognostiziert wurde – bis die Red Tide zuschlug.04.02.2015
Emden: Onno Marahrens eröffnet das „Fischhuus“
In Emden hat am 17. Januar 2015 mit dem „Fischhuus“ ein neues Fischgeschäft eröffnet, schreibt die Emder Zeitung. In der Fußgängerzone der ostfriesischen Hafenstadt, in der Straße 'Zwischen beiden Märkten', hat der Emder Gastronom und Hotelier Onno Marahrens (43) das ehemalige Fischfeinkostgeschäft „Nordseewelle“ übernommen, renoviert und wiedereröffnet. Im vorderen Bereich gibt es Fisch zum Mitnehmen, im hinteren Teil ist ein kleines Bistro eingerichtet. Irritationen soll nach Angaben der Lokalzeitung der Name „Fischhuus“ verursacht haben: das an das „Alt Emder Bürgerhaus“ in der Friedrich-Ebert-Straße angeschlossene Restaurant heißt seit 25 Jahren ebenfalls „Fischhuus“. Dessen Betreiber Matthias Baumgarten fürchtet jetzt Missverständnisse und Irriationen. Marahrens, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) in Emden, erklärte gegenüber der Lokalzeitung, die Namensgleichheit sei ihm nicht bewusst gewesen: „Ich kenne das Restaurant als 'Alt Emder Bürgerhaus', nicht als 'Fischhuus'.“ Obgleich das Restaurant in Emden seit 25 Jahren unter dem Namen bekannt ist, soll es aber unter diesem Namen nicht im Handelsregister eingetragen sein.04.02.2015
Herne: Bickers Räucherstube verkauft auf Wochenmärkten
Auf den Wochenmärkten der Ruhrgebietstadt Herne gibt es seit dem 1. Oktober 2014 eine mobile Fischräucherei. Gina und Daniel Bicker verkaufen an einem kleinen Stand Forellen, Lachs und Aal direkt aus dem Räucherofen, schreibt aktuell das Portal 'Der Westen'. Das Start-up „Bickers Räucherstube“ sei aus der Not geboren, berichtet Daniel Bicker. Nach einem doppelten Bandscheibenvorfall hatte er seine Tätigkeit als Außendienstmitarbeiter eines Getränkelieferservices aufgeben müssen. Als begeisterter Angler von Kindesbeinen kam er auf die Idee, sein Hobby – das Forellen-Räuchern für Freunde und Bekannte – zum ökonomischen Standbein für seine vierköpfige Familie zu machen. Nach einer dreimonatigen Marktbeobachtung in der Region kam er zu der Erkenntnis: Eine Räucherbude, an der Fisch direkt aus dem Rauch heraus verkauft wird, gab es bislang nicht. Die Investitionen von rund 4.000,- Euro für einen mobilen Räucherofen und die Gebühren für den wenige Quadratmeter großen Stand seien überschaubar gewesen. Von einem Züchter in Dülmen beziehe er seine Fische. Obwohl die Preise der Bickers über jenen von Mitbewerbern lägen, verkauften seine Frau und er zwischen 60 und 150 Forellen pro Tag. Die Räucherbude schreibe schon schwarze Zahlen, ohne Gründungsberatung oder -zuschuss. Nun soll ein zweiter Wagen angeschafft werden.03.02.2015
Island: Schellfisch- und Seelachs-Fischereien erneut als nachhaltig zertifiziert
Die isländischen Fischereien auf Schellfisch (Melanogrammus aeglefinus) und Seelachs (Pollachius virens) sind gemäß den Nachhaltigkeitsstandards des Iceland Responsible Fisheries Management-Programms (IRF) rezertifiziert worden, teilt die IRF-Stiftung mit. Das Programm beruht auf den Regularien der Welternährungsorganisation (FAO), die Bewertung der Fischereien lag in den Händen der unabhängigen, nach ISO 65 akkreditierten Global Trust Certification. Die Fangquoten für die beiden Fischarten betragen in der laufenden Fangsaison, die von September 2014 bis August 2015 läuft, 30.400 t für Schellfisch und 58.000 t für Seelachs.02.02.2015
Ciguatera: PTC Germany ruft Snapper-Filet zurück
Das Handelsunternehmen PTC Germany (Kempen) hat Snapper-Filets zurückrufen lassen, da diese Algengifte enthalten können, die die Erkrankung Ciguatera verursachen können. „Es gibt Hinweise, dass in einzelnen Fischfilets der Marke PTC Snapper mit Produktionsdatum: 11.11.2014, Mindesthaltbarkeit: 11.10.2015 und der LOT-Nummer: PTKVAC1301 Algentoxine enthalten sein können,“ schreibt PTC in einer Lebensmittelwarnung schon Anfang Dezember, „im Rahmen des präventiven Verbraucherschutzes haben wir uns zu einem Rückruf entschlossen.“ Der Vertrieb des Produktes sei über Metro Cash & Carry Deutschland erfolgt. Über ein durch PTC beauftragtes Callcenter sei jeder Kunde, der diesen Artikel bei der Metro erworben habe, informiert worden. Ciguatera ist eine besonders schwere und extrem langwierige Fischvergiftung. Fische, die Ciguatoxine tragen, sind weder krank noch verdorben, da sie selbst gegen die starken Nervengifte unempfindlich sind. Bisher gebe es keine Möglichkeit, von Ciguatoxin befallene Fische zu erkennen, schreibt die Anästhesistin Prof. Dr. Katharina Zimmermann in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift. Besonders betroffen sind exotische Raubfische wie Barracuda, Gelbschwanzmakrelen, Snapper und Zackenbarsche.29.01.2015
Norwegen: Mehr als 70 Prozent Pflanzenstoffe im Lachsfutter
Im Jahre 2013 betrugen die marinen Inhaltsstoffe im Futter norwegischer Zuchtlachse erstmals weniger als 30 Prozent, heißt es in einer neuen Studie des Lebensmittelinstituts Nofima. Zum Vergleich: im Jahre 1990 stammten 90 Prozent des Futters für Norwegens Farmlachse aus marinem Rohmaterial – 2013 waren es gerade einmal 29,2 Prozent, zitiert das Portal IntraFish die aktuelle Untersuchung. Alleine zwischen 2010 und 2013 sei der entsprechende Anteil um 15 Prozent gesenkt worden. Zu diesen marinen Rohstoffen zählen Fischöl, Fischmehl und Krillmehl. 72 Prozent hiervon kommen direkt aus der Fischerei, der Rest sind Abschnitte und Nebenprodukte. Bei den pflanzlichen Inhaltsstoffen handelt es sich vor allem um Sojaproteinkonzentrat und Rapssaatöl. Dabei sei inzwischen der Proteinanteil, den das Sojaproteinkonzentrat stellt, höher als der Proteinanteil aus Fischmehl. Von den insgesamt in Norwegen 2012 im Futter eingesetzten 50.000 t marinen Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA landeten etwa 13.000 t im verzehrbaren Produkt. Nach Angaben der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) reiche der wöchentliche Verzehr von 130 Gramm norwegischem Lachsfilet aus, um die empfohlene Aufnahme von EPA und DHA zu decken. Auftraggeber für die in Kooperation mit dem norwegischen Forschungsinstitut SINTEF und dem Schwedischen Institut für Lebensmittel und Biotechnologie (SIK) erstellte Studie ist der über eine 0,3 %ige Exportabgabe der Fischwirtschaft finanzierte Norwegische Seafood-Forschungsfonds (FHF).28.01.2015
Roßbrunn: Fischzucht-Gegner erstreiten Quellwassermessung
Unter dem Motto „Wiese statt Beton - Rettet das Aalbachtal“ leistet eine Bürgerinitiative im bayerischen Roßbrunn (Landkreis Würzburg) Widerstand gegen eine geplante Fischzucht des Züchters Walter Müller aus Birkenfeld. Dabei ist die Teilkreislaufanlage, in der einmal 250 Tonnen Saiblinge und Forellen pro Jahr gezüchtet werden sollen, bereits im Jahre 2011 vom Gemeinderat von Roßbrunn genehmigt worden, teilt der Bayerische Rundfunk auf seiner Internetseite mit. Auch folgende Gutachten seien positiv ausgefallen, so dass die oberste bayerische Baubehörde und das bayerische Landwirtschaftsministerium dem geplanten Bau als landwirtschaftlichem Großprojekt im Außenbereich grundsätzlich eine Privilegierung zugesprochen hatten. Doch jetzt haben die Gegner einen Teilerfolg errungen: am 26. Januar entsprach der Gemeinderat einem Antrag der Grünen, die Wassermenge der für die Fischzucht zu nutzenden Quelle erneut zu messen. Während für eine nachhaltige Produktion der Anlage eine Wassermenge von mindestens 50 Litern pro Sekunde erforderlich sei, hätten Messungen eine weitaus geringere Menge Frischwasser ergeben, sagt Sebastian Hansen, Ortsverbandsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen: „Wir hoffen, dass die Entscheidung für eine Messung der Einstieg in den Ausstieg aus dem Projekt ist.“28.01.2015
Fischgroßhandel Krone plant Erweiterung für rund 1,6 Mio. Euro
Der Fisch- und Feinkost-Großhandel Krone will am Hauptsitz in Steinbach sein Warenlager für bis zu 1,8 Millionen Euro renovieren und erweitern, schreibt die zur Frankfurter Neuen Presse gehörende Taunus-Zeitung. Krone, Lieferant unter anderem für Rewe, Edeka und Lidl, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten außerordentlich erfolgreich entwickelt, zitiert die Zeitung Geschäftsführer Lars Knobloch: der Umsatz stieg von 10 Mio. Euro Mitte der 1990er Jahre auf zuletzt 140 Mio. Euro im Ende Juni 2014 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2013/14. Entsprechend bestehe am Standort im Gewerbegebiet Steinbach Expansionbedarf. Neben Büroräumen von 500 Quadratmetern gibt es dort ein Warenlager von 1.500 Quadratmetern Fläche. Es sei eines von fünf Lagern, in denen vor Weihnachten mehr als 6.000 Paletten Fischprodukte lagerten, sagt Knobloch. Jetzt sollen zum einen die vorhandenen Räume für 600.000 bis 800.000 Euro renoviert werden, zum anderen sei für weitere 800.000 bis eine Mio. Euro ein Anbau von 600 bis 800 Quadratmetern geplant. Krone beschäftigt seit Jahresbeginn 40 Festangestellte (2014: 36) und weitere 40 Aushilfskräfte.28.01.2015