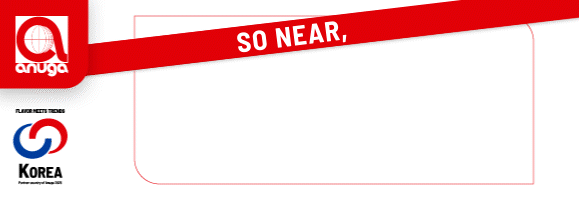08.06.2017
Fokken & Müller sowie Abrahams erneut 'Kulinarische Botschafter Niedersachsens'
41 Unternehmerinnen und Unternehmer erhielten am Dienstag, 6. Juni, vom niedersächsischen Ministerpräsident Stephan Weil Urkunden für insgesamt 53 ausgezeichnete Lebensmittel, die erfolgreich am Wettbewerb „Kulinarisches Niedersachsen“ 2017 teilgenommen hatten. Mit der Urkunde dürfen die Produkte jetzt offiziell als „Kulinarische Botschafter Niedersachsen 2017“ bezeichnet werden. Zu den Gewinnern gehören jetzt auch die Emder Matjesfilets in Öl aus dem Hause Fokken & Müller. Ministerpräsident Stephan Weil überreichte die Urkunde in der feierlichen Prämierungsveranstaltung, stellvertretend für das Unternehmen Fokken & Müller, an Klaas Müller. An dem Branchenevent nahmen rund 200 Branchenvertreter aus der Lebensmittelwirtschaft, dem Handel und der Gastronomie, sowie Politiker und Verbandsvertreter aus ganz Niedersachsen teil. Im vergangenen Jahr waren schon die Emder Räuchermatjesfilets ausgezeichnet worden.„Wir freuen uns über die Auszeichnung und werden als kulinarischer Botschafter Niedersachsens auch in Zukunft die gewohnte Qualität der Emder Matjesprodukte ausliefern“, erklärte Klaas Müller.06.06.2017
Nordsee baut Filiale Darmstadt zu Flagship-Store um
Die Restaurantkette Nordsee präsentiert sich an ihrem angestammten Standort in der Darmstädter Ludwigstraße nach zehnwöchigem Umbau auf neuestem konzeptionellen Stand. Der neue Auftritt, in den der Systemgastronom rund 1 Mio. Euro investiert hat, kombiniert Vintage-Stil mit modernem Design und Stilelementen, die den Bezug zur Region unterstreichen. So setzt eine Bildwand mit Jugendstil-Plakatkunst das legendäre Darmstädter Kleinod Mathildenhöhe in Szene. Die umgestaltete Filiale, die jetzt 90 Sitzplätze bietet (vorher: rund 70), punktet mit mehreren atmosphärischen Bereichen, die unterschiedlich möbliert sind. Ganz neu sind Hochsitze direkt an der Frischfisch- und Grilltheke, wo Gäste die Zubereitung des Fisches ihrer Wahl vom Meeresbuffet, der Retail-Theke der Nordsee, verfolgen können. Neu für das Darmstädter Publikum, aber systemweit bereits seit September 2016 fast 100-fach umgesetzt, ist der "Nordsee Fish to go": ein Kühlschrank im Eingangsbereich mit täglich frisch vor Ort zubereiteten Produkten zur Mitnahme. Rund 60% der bestehenden Nordsee-Stores in Deutschland sind inzwischen umgestaltet, das Investitionsprogramm läuft weiter.01.06.2017
Meeresschutz: Illegale Fischerei führt zu mehr "Geisternetzen"
Die internationale Tierschutzorganisation 'World Animal Protection' (WAP) nimmt zwei anstehende Konferenzen zum Anlass, die Regierungen weltweit zum Kampf gegen das wachsende Problem so genannter "Geisternetze" aufzurufen, meldet das Portal IntraFish. Vom 5. bis 9. Juni 2017 findet in New York die 'UN Ocean Conference' statt und vom 5. bis 7. Juni tagt in Seattle ebenfalls in den USA das 'Sea Web Seafood Summit'. Jährlich würden in den Weltmeeren geschätzte 640.000 t Netzmaterial verloren oder entsorgt - "discarded" -, teilt die WAP mit. Studien zufolge leiden mehr als 817 Arten marinen Lebens unter dem Müll in den Meeren. Die herrenlosen Netze fangen nicht nur Tiere wie Wale, Delfine, Robben und Meeresschildkröten, die oft einen langsamen, qualvollen Tod sterben. Das Netzmaterial zerfällt außerdem zu Mikroplastik und kann vom Menschen über den Fischverzehr aufgenommen werden. Mehr als die Hälfte des Fischs, der auf Märkten in Indonesien und Kalifornien verkauft wird, enthalte inzwischen Kunststoff aus unterschiedlichsten Quellen.01.06.2017
Island: Erste Capelin-Fischerei weltweit erhält MSC-Zertifikat
Die isländische Fischerei auf den Capelin (Mallotus villosus) wurde als weltweit erste Fischerei auf diese Art vom Marine Stewardship Council (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifiziert. Die Zertifizierung erstreckt sich auf isländische Fangschiffe, die die Lodde mit pelagischen Schleppnetzen und Ringwaden in isländischen Gewässern, vor der Ostküste Grönlands und um Jan Mayen im Nordostatlantik befischen. Der Capelin ist eine wichtige Fischart für die Fischmehlindustrie, liefert aber auch Rogen und wird als ganzer Fisch weltweit vermarktet, insbesondere in Osteuropa und Japan. Der Capelin-Rogen wird u.a. zu Masago verarbeitet und zu diesem Zweck klassischerweise orange gefärbt, aber auch gelb oder - mit Wasabi - grün. Masago wird beispielsweise als Topping auf Nigiri-Sushi serviert.31.05.2017
MSC will Fischölproduzenten von nachhaltiger Fischerei überzeugen
Ein Fünftel der Weltfangmenge wird nicht direkt für den menschlichen Verzehr verwendet, sondern geht in die industrielle Produktion von sogenannten Fischnebenprodukten. Während sich in der "Speisefischindustrie" das Bewusstsein für eine nachhaltige Produktion durchgesetzt hat, steckt die Umsetzung anerkannter Nachhaltigkeitskriterien in diesem Segment der Fischerei noch in den Kinderschuhen. Das will der Marine Stewardship Council (MSC) jetzt ändern. Bis zum Jahre 2020 sollen 20 Prozent des Fangs, der in die Fischölproduktion geht, aus MSC-zertifizierten nachhaltigen Fischereien stammen, so das Ziel der Organisation. "Darüber hinaus sollen in den kommenden drei Jahren fünf der Top 10 Fischölproduzenten von einer nachhaltigen Bewirtschaftung ihrer wichtigsten Ressource überzeugt werden und auf MSC-zertifizierte Rohware setzen", teilt der MSC mit.30.05.2017
Ecuador: Weitere Shrimp-Farmen von Songa zertifiziert
In Ecuador haben jetzt zwei weitere Garnelenfarmen des Züchters Sociedad Nacional Galapagos (Songa) eine Zertifizierung des Aquaculture Stewardship Councils (ASC) erhalten, teilt die Umweltorganisation mit. Songa, gegründet im Jahre 1968, ist die älteste Shrimpzucht in Ecuador und eine der ältesten in Südamerika. Aktuell bewirtschaftet Songa eine Fläche von 140.000 m2 und unterhält einen Verarbeitungsbetrieb von 36.300 m2 Betriebsfläche, der bis zu 125 t White Shrimps (Litopenaeus vannamei) täglich verarbeiten kann. Als einer der größten Shrimpexporteure des Landes verkauft Songa nach Europa, Asien und Nordamerika. Schon seit mehreren Jahren produziert der Züchter mit Rücksicht auf die Umwelt, so dass für das Erreichen der ASC-Zertifizierung keine größeren Veränderungen erforderlich gewesen seien. Im Sozialbereich habe Songa beispielsweise dafür gesorgt, dass die Arbeiter Ärzte auf den Farmen haben und ein Bonussystem wurde ebenso etabliert wie ein Kreditprogramm, über das die Beschäftigten ihre Lebensbedingungen verbessern oder die Ausbildung ihrer Kinder finanzieren können.29.05.2017
Hummer: US-Exporteure könnten unter CETA leiden
Nach Ratifizierung des CETA-Handelsabkommens zwischen Kanada und der Europäischen Union könnten die US-amerikanischen Hummer-Exporte in die EU abnehmen, schreibt die Business View Canada. Denn CETA sieht vor, dass die kanadischen Hummer in Zukunft zollfrei in die EU exportiert werden, während US-Exporteure weiterhin 8% Zoll für den Versand lebender Hummer und 20% für verarbeiteten oder gekochten Hummer zahlen müssen - im Durchschnitt etwa 11%. Im Jahre 2016 importierte die EU Hummer im Wert von mehr als 140 Mio. CAD (= 92,7 Mio. Euro) aus Kanada sowie Hummer für 150 Mio. USD (= 134 Mio. Euro) aus den USA. Der kanadische Wert dürfte demnächst erheblich steigen. Hinzu kommt, dass die kanadische Regierung einen Fonds in Höhe von 325 Mio. CAD (= 215,2 Mio. Euro) aufgelegt hat, um die Seafood-Industrie des Landes zu fördern. Das "Lobster Council of Canada" (LCC) will das Geld für Marketing, Forschung und Entwicklung sowie weitere Verbesserungen ausgeben, um die Marke "Canadian Lobster" zu bewerben, insbesondere in Europa. Im Januar hatte auch China seine Einfuhrzölle auf Seafood aus Kanada reduziert. Nach China exportierte Kanada bis einschließlich Oktober 2016 Seafood im Wert von 634 Mio. CAD (= 419,8 Mio. Euro).29.05.2017
Alaska: Lachsfischerei im Prinz-William-Sund ist nachhaltig
Die gesamte Lachsfischerei in Alaska, jetzt auch einschließlich der Fischerei im Prinz-William-Sund (PWS), ist erneut vom Marine Stewardship Council (MSC) als nachhaltig zertifiziert worden, meldet der MSC. Nachdem die Lachsfischerei erstmals im Jahre 2000 zertifiziert und 2007 rezertifiziert worden war, wurde bei einer erneuten Rezertifizierung im Jahre 2013 entschieden, dass die PWS-Einheit vorläufig nicht zertifiziert, sondern weiter geprüft werden sollte. Währenddessen analysierte Alaskas Behörde für Fisch und Wild (ADF&G) im Rahmen einer mehrjährigen Studie die Auswirkungen von Hatcheries auf die Populationen von Wildlachs und Hering im PWS. Auf Grundlage der Ergebnisse des 'Brutanstalten-Forschungsprogramms für Alaska' (Alaska Hatchery Research Program) entschied das Zertifizierungsteam, dass die Einflüsse der Brutanstalten auf die Wildlachsbestände gering seien und den Nachhaltigskeitsanforderungen des MSC-Fischereistandards genügten.26.05.2017
Grönland: Weltweit erste Fischerei auf Schwarzen Heilbutt MSC-zertifiziert
Die Fischerei auf den Schwarzen Heilbutt (Reinhardtius hippoglossoides) vor der Westküste von Grönland ist vom Marine Stewardship Council (MSC) als nachhaltig und gut gemanaged zertifiziert worden. Damit trägt weltweit erstmals eine Fischerei auf diese Fischart das MSC-Zertifikat. Im März 2016 hatte 'Sustainable Fisheries Greenland' (SFG) die Prüfung beantragt, die von dem unabhängigen Auditierer DNV GL nach dem aktualisierten MSC-Fischereistandard v2.0 bewertet wurde. Die Fischerei wird von vier Trawlern in der Baffin-Bucht und in der Davisstraße mit Bodenschleppnetzen betrieben. Für das Management ist Grönlands Ministerium für Fischerei und Jagen verantwortlich, das auch die jährlichen Fangquoten festlegt. Der Schwarze Heilbutt (engl. Greenland halibut) lebt um die Arktis sowohl im Atlantik als auch im Pazifik bei Wassertemperaturen von 1 bis 4 Grad Celsius und wird bis zu 1,2 Meter lang. Im Gegensatz zu anderen Plattfischarten, die nur auf der Oberseite dunkel, auf der Unterseite aber hell sind, ist der Schwarze Heilbutt auf beiden Seiten dunkel. Der wertvollste Plattfisch in Grönlands Gewässern wird vor allem nach China und Japan exportiert als Filet für Sushi und Sashimi. In Europa sind Deutschland und Spanien die wichtigsten Märkte.26.05.2017
Lachspreise: Eine Ursache sind die Ausfälle in Chile
Norwegens Fischindustrie begrüßte die hohen Lachspreise zum Abschluss des 1. Quartals 2017 als "gute Nachricht", schreibt Fish Information & Services (FIS). Für die im Vorjahresvergleich um bis zu 40% höheren Preise machen die Norweger u.a. die geringeren Erntemengen in Chile verantwortlich. Weltweit lag die Erntemenge beim Atlantischen Lachs im ersten Vierteljahr mit 470.600 t etwa 4% niedriger als im 1. Quartal 2016, berichtet Marine Harvest. Salmar schätzt die Lachsmenge für die ersten drei Monate auf 516.900 t - 5% weniger als in I/2016: "Der Rückgang hängt vor allem mit der niedrigeren Produktion in Chile zusammen, die gegenüber dem Vergleichsquartal um 21% geringer ausfiel." Insgesamt hatte Chile 2016 durch eine Algenblüte 135.000 t Lachs verloren. Darüberhinaus verweist Salmar auf die Lachsproduktion in Nordamerika und auf den Färöer Inseln: die Amerikaner ernteten im 1. Quartal 35.100 t - ein Minus von 5% - und auf den Färöern lag die Produktion mit 16.600 t sogar 12% unter dem Ergebnis 2016. Diese Einschätzung teilt Norway Royal Salmon, die wie alle norwegischen Züchter profitieren: so exportierte Norwegen im 1. Quartal 4% mehr Lachs, während der Wert der Exporte 21% höher lag als im 1. Quartal 2016.- Landwirtschaft
- Aquakultur
- Niedersachsen
- Landjugend
- Aal-Hof Gö...
- Cloppenburg
- Wolfsbarsch
- Niehues
- Münster
- Geflossenschaft
- Ulrich Averberg
- Mikroalgen
- Stefan Feichtinger
- illegale Fischerei
- IUU-Fischerei
- Welthandelsorganisation
- WTO
- Abkommen
- Subventionen
- Ngozi Okonjo-Iweala
- Marine Stewardship ...
- Aquaculture Stewardship ...
- MSC
- ASC
- Check deinen ...
- Florian Zerbst
- Fischsommelier