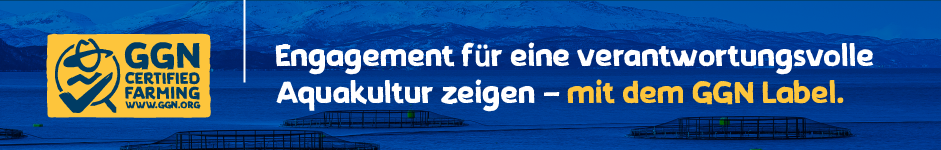06.11.2013
USA: MSC-Direktorin Kerry Coughlin tritt zurück
Kerry Coughlin, Regionaldirektorin des Marine Stewardship Councils (MSC) für Nordamerika, hat am Freitag mitgeteilt, dass sie zu Ende November aus ihrem Amt ausscheiden werde. Coughlin war in dieser Funktion seit vier Jahren tätig. MSC-Geschäftsführer Rupert Howes lobte ihre Arbeit der vergangenen sechs Jahre und sprach von "ihrem bedeutenden Beitrag". Coughlins Ausscheiden folgt monatelanger scharfer Kritik am MSC vor allem aus Alaska. Der Organisation wird vorgeworfen zu versuchen, den Markt für nachhaltig gefangenen Fisch und Meeresfrüchte zu monopolisieren und insbesondere Unternehmen aus Alaska, die das MSC-Programm verlassen hatten, auszubooten.05.11.2013
Niederlande: Seezungen-Fischer verlassen das MSC-Programm
Holländische Kiemennetzfischer, die in der Cooperative Fisheries Organisation (CVO) zusammengeschlossen sind, haben beschlossen, für ihre Seezungen-Fischerei in der Nordsee keine Verlängerung des MSC-Zertifikats zu beantragen. "In den vergangenen Jahren haben mehrere Versuche, die finanzielle Mehrbelastung über die Preise auszugleichen, nicht genug erlöst, um das Zertifikat weiter aufrecht zu erhalten", erklärte die Gruppe. Die Fischer der CVO hatten die MSC-Zertifizierung für die Seezunge (Solea solea) im November 2009 erhalten. Obgleich das MSC-Zertifikat zwar die Nachhaltigkeit der Kiemennetzfischerei unterstrichen und ihnen auch öffentliche Anerkennung gebracht habe, seien das erwartete Preispremium für die MSC-Seezunge oder der Zugang zu speziellen Märkten ausgeblieben. Ab dem 24. November gebe es daher von der CVO keine MSC-zertifizierte Seezunge mehr. In mehreren Treffen zwischen der CVO und dem MSC habe man keine Gebührensenkung für das anstehende jährliche Audit durchsetzen können. Langfristig wolle der MSC allerdings mehrere Veränderungen einführen, um kleineren Fischereien die MSC-Zertifizierung zu erleichtern.05.11.2013
Färöer wollen Welthandelsorganisation wegen EU-Sanktionen anrufen
Die Färöer-Inseln wollen bei der Welthandelsorganisation (WTO) Beschwerde gegen die von der Europäischen Union verhängten Handelssanktionen erheben, meldet das Portal IntraFish. Im August hatte die EU im Zusammenhang mit dem seit Monaten andauernden Konflikt um die Makrelen- und Heringsfangquoten der Färöer ein Embargo verhängt: Fangschiffe der Inselgruppe dürfen keine Makrelen oder Heringe in Häfen der Gemeinschaft anlanden oder in die EU exportieren. Fisch macht mehr als 90 Prozent der färingischen Exporte aus, so dass die Maßnahmen die Wirtschaft der zu Dänemark gehörenden autonomen, gut 50.000 Einwohner zählenden Inseln erheblich schwächen würden, meint The Copenhagen Post. Da die Färöer darauf beharren, dass die Sanktionen gegen die WTO-Regularien verstoßen, haben sie sich jetzt an Dänemark gewendet mit der Bitte, Beschwerde zu erheben. Dänemarks Außenministerium erklärte, dass es den Färöern bei der Verfolgung seiner Interessen nicht im Wege stehen wolle. Allerdings sehen sich dänische Poilitker jetzt in einer kniffligen Situation, da Dänemark sowohl der EU als auch der WTO angehört.04.11.2013
Norwegen: Marine Harvest erhöht Morpol-Beteiligung auf 99,7 Prozent
Der norwegische Lachsproduzent Marine Harvest hat weitere 9,1 Mio. Anteile des polnischen Lachsräucherers Morpol zum Preis von 11,85 NOK/Aktie - das sind 1,50 Euro - erworben, teilt das Portal IntraFish mit. Damit halte Marine Harvest jetzt 167.439.830 Morpol-Aktien, was 99,7 Prozent aller emittierten Aktien entspreche. Am 23. Oktober hatte der weltgrößte Lachszüchter angekündigt, noch bis Mittwoch, den 6. November 2013, 16:30 Uhr, sämtliche ihm angebotenen Morpol-Aktien zu demselben Preis zu kaufen.04.11.2013
Norwegen: Havfisk profitiert von hohen Schellfisch-Preisen
Havfisk, Norwegens größtes Trawler-Unternehmen, konnte das 3. Quartal 2013 mit einem Ergebnis (EBITDA) abschließen, das 55 Prozent über dem Vergleichsquartal 2012 lag, meldet Fish Information & Services (FIS). Die Betriebserträge lagen mit 31,4 Mio. USD gut 3 Mio. USD höher als in III/2012. Zu verdanken sei dies insbesondere höheren Preisen für Schellfisch. Dabei war der Fangmix im 3. Quartal, insgesamt 13.039 t, ein anderer als 2012: mehr Kabeljau (65% statt 41%), aber weniger Schellfisch (19% statt 34%) und weniger Seelachs (11% statt 21%). Ende des 3. Quartals besaß Havfisk noch rund 1.400 t mehr Kabeljau und Schellfisch als Ende II/2012, eine gute Basis für das letzte Quartal.04.11.2013
Ganderkesee: Oltmanns schließt Fischgeschäft, verkauft aber mobil
Hendrik Oltmanns hat sein Fischgeschäft "Der Fischladen" im niedersächsischen Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) nach acht Jahren geschlossen, meldet das Delmenhorster Kreisblatt. Allerdings werde der 37-jährige Fischwirt seine Fischfeinkost weiterhin als mobiler Fischhändler im Landkreis an täglich wechselnden Standorten anbieten. Von Dienstags bis Freitags werde er als Ein-Mann-Unternehmen vor Supermärkten etwa in Wüsting, Bookholzberg und Rastede/Wahnbek stehen. Seinen ehemaligen Fischladen in der Passage des alten Famila-Marktes am Markt bietet Hendrik Oltmanns inzwischen zur Miete an, das von einem Ladenbauer maßgefertigte Inventar möchte er verkaufen. Im Ortskern von Ganderkesee gibt es jedoch weiterhin Frischfisch: der neue Famila-Markt an der Grüppenbührener Straße verfügt über eine eigene Fisch-Bedientheke.04.11.2013
Gutachten: Fische profitieren von Offshore-Windparks
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
01.11.2013
Norwegen: ISA-Ausbruch im Süden, 180.000 Lachse getötet
In einer Lachszucht im Südwesten Norwegens sind 180.000 Lachse notgeschlachtet worden, weil in der Farm mutmaßlich die Lachsseuche ISA ausgebrochen ist, schreibt das Portal IntraFish. Die Fische mit einem Gewicht von 250 Gramm waren erst im August eingesetzt worden. Der ISA-Ausbruch ist der erste bestätigte Fall der Infektiösen Salmanämie in Südnorwegen seit acht Jahren, teilte die Norwegische Behörde für Lebensmittelsicherheit (FSA) mit. Um eine Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, werden insbesondere benachbarte Farmen und die Ernteschiffe, die Wellboats, streng überwacht. Außerdem arbeite die FSA an der Einrichtung einer Kontroll- und Überwachungszone in der Region.01.11.2013
Kanada: Viele Hummer zu niedrigen Preisen
In der kanadischen Hummerfischerei hält der in ganz Nordamerika zu beobachtende Trend an: wachsende Anlandemengen drücken die Preise. So landeten die Fischer in den drei Fangbezirken von Prince Edward Island (PEI) in diesem Jahr insgesamt 28.768.817 Pounds (13.061 t) an, während es 2012 nur 27.235.880 Pounds (12.365 t) waren - ein Plus von 5,6 Prozent. Dennoch erlösten die Fischer für die gestiegenen Fangmengen fast 20 Prozent weniger: 91,4 Mio. USD (2013) statt 113,8 Mio. USD (2012) - das sind 66,5 Mio. Euro statt 82,7 Mio. Euro im Vorjahr. Allerdings lagen sie damit über den Erlösen der Jahre 2009 bis 2011, die sich zwischen 72 Mio. USD und 82 Mio. USD bewegten. "Wenn der Preis zwischen 4,- und 4,25 USD/Pound gelegen hätte, hätten die Fischer einen kleinen Gewinn machen können. Aber wenn Sie auf die Kosten für die Köder, den Treibstoff und die Mitarbeiter schauen - alles steigt, nur nicht die Hummerpreise für die Fischer an der Kaje", kritisiert Ron MacKinley, Minister für Fischerei, Aquakultur und ländliche Entwicklung auf PEI. Während die Fischer im Frühjahr noch 2,75 USD/Pound (4,41 Euro/kg) für 'canners' und 3,25 USD/Pound (5,20 Euro/kg) für 'markets' erhielten, begann die Herbstsaison mit 2,50 USD/Pound (4,01 Euro/kg) bzw. 2,75 USD/Pound (4,41 Euro/kg) für die beiden Klassifizierungen. Einen leichten Preisanstieg von 0,25 USD/Pound (,40 Euro/kg) während der Herbstsaison wertete MacKinley als Zeichen dafür, dass es durchaus Nachfrage gebe.31.10.2013