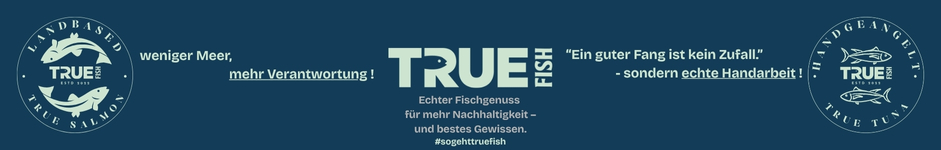15.05.2019
Rotenburg: Fahrzeugwerk Borco-Höhns beantragt Schutzschirmverfahren
Der Rotenburger Hersteller von Verkaufsfahrzeugen, Borco-Höhns, hat Mitte April beim Amtsgericht in Walsrode ein so genanntes Schutzschirmverfahren beantragt, meldet die in Syke erscheinende Kreiszeitung online. Das Gericht hat daraufhin Stefan Denkhaus von der Hamburger Kanzlei BRL Boege, Rohde, Luebbehuesen zum vorläufigen Sachwalter für die Fahrzeugwerk Borco-Höhns GmbH & Co. KG, die Heineke-Borco GmbH & Co. KG sowie die Hinrich Heineke GmbH bestellt. Das Schutzschirmverfahren könne als Vorstufe eines möglichen Insolvenzverfahrens bezeichnet werden. Allerdings teilte Alexander Starnecker, der gmeinsam mit Andreas Elsäßer die Geschäfte des 270 Mitarbeiter-Unternehmens führt, mit, dass mittels des Schutzschirmverfahrens die weitere Sanierung des Produzenten von Verkaufsfahrzeugen und -anhängern verwirklicht werden solle. "Die Gespräche zu unserem Wachstums- und Sanierungskonzept waren mit Finanzierern sowie mit Gesellschaftern weit fortgeschritten, konnten jedoch nicht zeitgerecht abgeschlossen werden", heißt es in einer Mitteilung von Elsäßer.14.05.2019
Dänemark: Insula übernimmt Fischkonservenhersteller Bornholms
Insula, ein Unternehmen des norwegischen Investors Kverva, übernimmt die Konservenmarke Bornholms, melden die Undercurrent News. Die Bornholms-Fabrik (Jahresumsatz: 15 Mio. Euro) auf der dänischen Ostseeinsel Bornholm werde geschlossen, die Produktion in die Fabrik der Insula-Tochter Amanda Seafoods im norddänischen Frederikshavn integriert. Insula hatte Ende 2018 bereits die beiden Frischfischverarbeiter Knud Søndergaard Fiskeeksport und Famm Seafood geschluckt, die jetzt als Insula Hvide Sande und Insula Hanstholm geführt werden. Sie stellen unter der Marke Amanda Frischfisch in MAP- und Skinverpackung her. Kverva gehört der Familie Witzøe, den Gründern des Lachsproduzenten SalMar.14.05.2019
USA/China: Handelskrieg eskaliert
Ende vergangener Woche haben die USA bestehende Sonderzölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Mrd. USD angekündigt. Davon betroffen sind auch zahlreiche Fischprodukte und Meeresfrüchte, deren Einfuhrzölle aus China in die USA sich von bislang 10% auf 25% erhöhen, schreibt IntraFish. Das betrifft ganze Forelle, frisch oder gekühlt, und Pazifischen Wildlachs, ganzen gefrorenen Sockeye-Wildlachs, gefrorenen Atlantischen Lachs, Alaska-Pollack, Hummer-Produkte, Kaltwassergarnelen sowohl gekocht mit Schale als auch ungekocht, frisches oder gekühltes Krebsfleisch und lebende Krebse, Langusten, Scallops mit und ohne Schale, darunter frische oder gekühlte 'Queenscallops". Desweiteren stehen auf der Liste Wolfsbarsch und Dorade, weitere Meeresfrüchte wie Muscheln, Abalone, Herz- und Venusmuscheln sowie Zehnfußkrebse (Tintenfisch-, Kalmar- und Oktopus-Erzeugnisse). Im Gegenzug will China ab dem 1. Juni diesen Jahres 5.140 US-Produkte im Gesamtwert von mehr als 60 Mrd. USD ebenfalls einem erhöhten Einfuhrzollsatz unterwerfen, darunter voraussichtlich auch Räucherlachs und Fischöl.03.05.2019
Holland: Seefischgroßhandel Van Slooten hat Insolvenz angemeldet
Der niederländische Fischverarbeiter Zeevisgroothandel van Slooten hat am 4. April Insolvenz angemeldet, nachdem er erst Anfang vergangenen Jahres am Standort Urk eine neue Fabrik in Betrieb genommen hatte, melden die Undercurrent News. Wir haben "bis zum Ende gekämpft", sagt Unternehmenssprecher Louw van den Berg. Seinen Angaben zufolge habe ein Partner den Großhandel bereits im Januar 2018 verlassen. Dessen negative Äußerungen gegenüber Lieferanten und Kunden hätten das Unternehmen Umsätze in Höhe von 4 Mio. Euro gekostet. Seit August 2018 habe van Slooten Liquiditätsprobleme gehabt. Obwohl Anfang 2019 der Vertrag mit einem Investor kurz vor dem Abschluss gestanden habe, warnte zu diesem Zeitpunkt der Lieferant Norwegian Seafood Company (Norseaco) davor, mit dem Zeevisgroothandel Geschäfte zu tätigen. Norseaco klagte schließlich gegen van Slooten auf Zahlung ausstehender Gelder. Inzwischen habe die finanzierende Bank sich die neue Van Slooten-Fabrik gesichert. Da momentan in Urk keine Produktionsräumlichkeiten zum Verkauf stünden, gehen Insider davon aus, dass sie für das 2.500 qm große Gebäude schnell einen Käufer finden werde. Van Slooten belieferte Kunden in den Benelux-Ländern, aber auch in Deutschland und der Schweiz.03.05.2019
Holland: Het Urker Zalmhuys übernimmt den Händler Affish
Der niederländische Lachsverarbeiter Het Urker Zalmhuys hat das ebenfalls in Holland ansässige Im- und Exportunternehmen Affish übernommen, teilte Zalmhuys-Geschäftsführer Harm ten Napel den Undercurrent News mit. Während Zalmhuys vor allem Frischlachs filetiert, portioniert und verpackt, aber auch räuchert, handelt Affish ein umfassenderes Sortiment, darunter Shrimps, Fisch, Tintenfisch und Muscheln. Motiv für die Übernahme von Affish sei das Bestreben, das Tiefkühlsortiment von Zalmhuys auszubauen, nachdem sie in Urk ein neues Kühlhaus errichtet hatten. Und: "Diederik van Spronsen und ich, die Direktoren von Zalmhuys, sind beide jung, wir wollen das Geschäft ausbauen", erklärte Ten Napel, der auch die Geschäftsführung von Affish übernommen habe. Affish gehörte mehrere Jahre bis Ende 2018 der britischen Gruppe Camellia, die jedoch keine Beziehung zum Fisch gehabt habe. Kombiniert rechnen Het Urker Zalmhuys und Affish für 2019 mit einem Umsatz von 85 Mio. Euro. Zunächst werden beide Unternehmen getrennt unter ihren bisherigen Namen agieren, haben jedoch begonnen, ihren Kunden die Produkte des jeweils anderen mit anzubieten.02.05.2019
Holland/Deutschland: Muschelproduzenten Barbé- und Leuschel-Gruppe fusionieren
Zwei führende europäische Produzenten frischer Miesmuscheln - die Barbé-Gruppe in den Niederlanden und die Leuschel-Gruppe in Deutschland - haben sich zum 1. Mai zusammengeschlossen, um die steigenden Anforderungen ihrer internationalen Kunden zu erfüllen. "Neben einer größeren Vielfalt an Muschelzuchtgebieten entsteht damit das größte Verarbeitungs- und Handelsunternehmen für frische Muscheln", teilt Simon Leuschel, Geschäftsführer der Leuschel-Gruppe, mit. Die neue Aqua Mossel v.o.f. unter der Geschäftsführung von Floris de Groot und Leuschel-Partnerin Inger Risdal Næss-Schmidt werde jährlich 15 bis 20 Mio. kg frische Muscheln produzieren, schätzt Leuschel. Bei einer Gesamtjahresproduktion von rund 50 Mio. kg in Holland und fast 20 Mio. kg in Deutschland besitzt Aqua Mossel damit einen Marktanteil von etwa 25 Prozent. Aqua Mossel verfüge über die besten Zuchtgebiete in Holland, Deutschland und Irland, sagt Leuschel, dessen Handelsniederlassung in Düsseldorf ansässig ist. Die Verarbeitung von Aqua Mossel in der holländischen "Muschelhauptstadt" Yerseke werde derzeit umgerüstet, um die kombinierte Muschelmenge der beiden Produzenten so effizient wie möglich zu verarbeiten. Für die diesjährige Saison prognostiziert Simon Leuschel gute Erträge. Sein Bruder Adriaan Leuschel habe am 1. Mai bei Tauchgängen vor Sylt große Schalen registriert, nur der Fleischgehalt der Miesmuscheln müsse bis zum Beginn der Saison etwa Mitte Juni noch steigen.30.04.2019
Türkei exportiert 9% mehr
Die Türkei hat ihre Exporte von Aquakulturprodukten in den vergangenen acht Monaten - von September 2018 bis April 2019 - im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum der Vorjahre um 9% auf 522,1 Mio. Euro steigern können, berichtet das Nachrichtenportal A News. Nach Angaben der Eastern Black Sea Exporters Association (DKIB) stieg die Menge der Ausfuhren im entsprechenden Zeitraum um 28% auf 93.169 t. Hauptexportländer für TK-Fisch und -Fischfilets waren die Niederlande (Exportwert: 78,5 Mio. Euro), Japan (54 Mio. Euro) und Italien (52,6 Mio. Euro).29.04.2019
Aale: Wasserkraft-Turbinen verursachen schwere Wirbelsäulenschäden
Aale werden auf ihren Wanderungen nicht nur von den Turbinen der Wasserkraftanlagen zum Teil regelrecht gehäckselt. Vielmehr erleiden viele überlebende, äußerlich unverletzte Tiere innere Verletzungen. Das ist die Erkenntnis einer Studie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, für die an der Weser gefangene Alle geröntgt wurden. Die Bilder zeigen, dass äußerlich unversehrte Tiere zu rund 50% teils schwerwiegende Wirbelsäulenverletzungen aufwiesen. Es gibt Stauchungen und Verschiebungen von Wirbelkörpern sowie Wirbelbrüche, die in dieser Form bei Menschen zu Gesundheitsschäden bis hin zu motorischen Ausfallerscheinungen und Querschnittslähmungen führen. Mit zunehmender Körperlänge steigt die Häufigkeit der Verletzungen. Abwandernde Blankaale, insbesondere große Weibchen, sind überproportional betroffen, wenn sie die Flüsse auf dem Weg in Laichgebiete in der karibischen Sargasso-See verlassen. Nach Einschätzung der Veterinäre können diese Wirbelsäulenverletzungen erhebliche Folgen für die Schwimmfähigkeit der Aale haben.26.04.2019
Thailand: CP Foods nutzt Vietnam als Export-Hub
Thailands führender Konzern Charoen Pokphand Foods will mehr als 200 Mio. USD - fast 180 Mio. Euro - investieren, um im Nachbarland Vietnam eine Export-Drehscheibe für Geflügel und Schweinefleisch, aber auch für seine Garnelen und Fisch zu errichten, meldet die Nikkei Asian Review. Der Hintergrund: der thailändische Exporteur will von Vietnams Mitgliedschaft im Freihandelsabkommen CPTPP - der Comprehensive and Progressive Trans Pacific Partnership - profitieren, das für Vietnam am 14. Januar 2019 in Kraft getreten ist. Außerdem könne CP Foods die Exportquote Vietnams nutzen, sagte ein Analyst des führenden thailändischen Finanzberaters Bualuang Securities. Mit Unterstützung der Regierung Vietnams will CP Food außerdem seine Produktionskapazität für Shrimp in Vietnam vervierfachen - von derzeit 12 auf 50 Mrd. "Einheiten". Hierfür soll schon 2019 die jährliche Produktionsmenge für Shrimpfutter von derzeit 300.000 auf 500.000 t gesteigert werden, teilte ein für den Bereich Fischprodukte Verantwortlicher bei CP Vietnam mit.26.04.2019