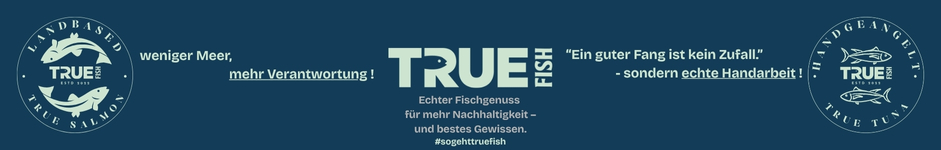26.10.2008
MSC eröffnet Büro in Südafrika
Der Marine Stewardship Council (MSC) hat ein erstes Büro in Afrika eröffnet. Die Filiale im südafrikanischen Kapstadt soll das Zertifizierungsprogramm in den Entwicklungsländern des Kontinents etablieren, und zwar in enger Zusammenarbeit mit der dortigen Fischwirtschaft. „Nachhaltige Fischerei kann in Afrika in erheblichem Maße zur Sicherung der Ernährungsgrundlage, der Bekämpfung von Armut und zur ökonomischen Entwicklung beitragen“, sagte Oluyemisi Oloruntuyi, MSC-Programm-Manager für die Entwicklungsländer. Das Büro unter Leitung von Martin Purves soll unter Einbezug sämtlicher Interessengruppen insbesondere in den Ländern Tansania, Mosambik, Namibia, Madagaskar und Südafrika Verständnis für das MSC-Programm und seine Vorzüge schaffen. Purves bringt langjährige Erfahrung als Fischereiberater, Wissenschaftler und wissenschaftlicher Beobachter mit.26.10.2008
Norwegen: NSEC will MSC-Label für Arktischen Kabeljau und Schellfisch
Der Norwegische Seafood-Exportrat (NSEC) hat einen Antrag auf Zertifizierung der norwegischen Fischerei auf nordostatlantischen Kabeljau und Schellfisch gestellt, teilt der Marine Stewardship Council (MSC) mit. Wenn das Verfahren erfolgreich abgeschlossen wird, dürfen 174.000 t Kabeljau und 76.500 t Schellfisch das blaue MSC-Logo tragen. Im vergangenen Jahr hatte schon die norwegische Fischereigruppe Domstein um die Zertifizierung seiner Fischerei von 7.000 t nordostatlantischem Kabeljau und Schellfisch nachgesucht. Betrieben wird der Fischfang von einem breiten Spektrum unterschiedlicher Schiffe, von großen modernen Hochsee-Trawlern bis hinunter zu kleinen Booten der Küstenfischerei. Auch das Fanggerät ist vielfältig: gefischt wird auf beide Spezies mit Schleppnetz, Langleine, „dänischem Wadennetz“ (Danish seine), Handleine und Kiemennetz. Die Fanggebiete liegen nördlich des 62. Breitengrades innerhalb der norwegischen Ausschließlichen Wirtschaftszone. Vermarktet wird der Fisch weltweit: in Südeuropa und Lateinamerika als Salzfisch, Klipp- und Stockfisch, in Deutschland, Frankreich und Großbritannien als frisches Filet und TK-Fisch.26.10.2008
Großbritannien: Erster Kontrakt-Caterer erhält MSC-Zertifizierung
Die Compass Group in Großbritannien und Irland hat sich als erster britischer Vertrags-Caterer erfolgreich einer Produktketten-Zertifizierung nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) unterzogen, meldet die norwegische Zeitung IntraFish. Compass, weltweit einer der größten Caterer, darf jetzt zunächst fünf seiner Kunden mit nachhaltig gefangenem Fisch versorgen, darunter 42 Westminster-Schulen. Neil Pitcairn, Fisch- und Seafood-Einkäufer für die britische Compass-Tochter, kündigte an, dass weitere Zertifizierungen folgen sollen. „Da wir jetzt Erfahrung mit dem Bewertungsprozess des MSC besitzen, wird es für andere Restaurants und Kantinen leichter sein“, sagte Pitcairn.24.10.2008
‚Matjes on Ice’ wieder auf Tour
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
22.10.2008
Tifa begrüßt neues Mitglied
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/clients/client2/web8/web/inc/db-news-display.php on line 47
21.10.2008
Japan: Erste Fischerei für Skipjack-Thun startet Zertifizierung
Der japanische Thunfischverarbeiter Tosakatsuo Suisan ist mit seiner Pole and line-Fischerei auf Skipjack-Thun (Echter Bonito) in die Hauptphase einer Zertifizierung nach den Kriterien des Marine Stewardship Councils (MSC) eingetreten, teilt der MSC mit. Damit unterzieht sich eine zweite japanische Fischerei und weltweit erstmals eine Fischerei auf den Echten Bonito dieser Überprüfung ihrer Nachhaltigkeit. Die japanische Hochseefischerei auf Thun mit der Pole and line-Methode fängt jährlich etwa 60.000 bis 70.000 t, wovon 4.000 t (7%) auf die Fangschiffe von Tosakatsuo Suisan entfallen. Die Fischerei wird saisonal von November bis Mai im Südpazifik betrieben und wandert in den Monaten September und Oktober weiter in die Gewässer nördlich und östlich von Japan. Tosakatsuo verarbeitet ausschließlich erstklassigen Skipjack der Qualitätskategorie B-1, der sich für den Sushi- und Sashimi-Markt eignet. B-1 oder Brine First Class bedeutet, dass der am Haken gefangene Fisch lebend in Tanks mit Kältemischungen mit einer Temperatur von –20 °C geworfen und nach dem Gefrieren auf –50 °C gefrostet wird. Tosakatsuo produziert vor allem Tataki-Skipjack, wobei der Bonito über brennendem Stroh kurz angebraten wird. Ist die Zertifizierung, durchgeführt von Moody Marine, erfolgreich, öffnen sich dem Unternehmen auch international neue Märkte.20.10.2008
Störzucht: Sortierung anhand biometrischer Daten
Ingenieure einer Fachhochschule im schweizerischen Bern entwickeln eine Sortieranlage für Zuchtstöre, die mit biometrischen Daten des Fischs arbeitet, schreibt die Zeitung ‚Der Bund’. In der Störzucht im Tropenhaus Frutigen (siehe auch FischMagazin 10/2008) müssen die Fische regelmäßig nach Größe sortiert werden, damit sie gleichmäßig aufwachsen können. Bisher erfolgt die Sortierung manuell. Nun haben drei junge Ingenieure vom Institut für mechanotronische Systeme der Berner Fachhochschule in Burgdorf einen Tunnel entwickelt, in dem die Fische fotografiert werden. Angelockt durch Strömung oder Dunkelheit, durchschwimmen die Störe die im Zuchtbecken installierte Anlage und werden bei Gegenlicht fotografiert, um eine scharfe Silhouette des Fischs zu erhalten. Die Elektroingenieure Thomas Fankhauser und Thomas Niederhauser sowie der Maschineningenieur Christian Wasserfallen wollen in einem nächsten Schritt den Fisch nicht nur anhand seiner Größe identifizieren, sondern mit Hilfe eines Musters, das die Störe auf Stirn und Seitenkiemen tragen. Sie gehen davon aus, dass dieses millimeterdicke Muster so einmalig ist wie der menschliche Fingerabdruck. Gelingt das Fotografieren mit einer hochauflösenden Digitalkamera, muss der Fisch nicht mehr mit einem Chip versehen werden, wie dies bislang geschieht. Ist das von der Förderagentur für Innovation des Bundes finanziell unterstützte Projekt erfolgreich, soll die Anlage weltweit vertrieben werden.17.10.2008
Preiskampf: Krabbenfischer bleiben an Wochenenden im Hafen
Die Mehrzahl der deutschen und niederländischen Krabbenfischer wird vorläufig an Wochenenden nicht mehr zum Fang hinausfahren, meldet die Emder Zeitung. Durch die dann etwa 20 bis 25 Prozent geringeren Krabbenanlandungen sollen die Preise stabilisiert werden. Momentan erhalten die Fischer je nach Größe etwa 1,60 bis 2,10 Euro pro Kilo. „Davon kann kein Betrieb existieren“, sagt Dirk Sander, Präsident des Fischereiverbandes Weser-Ems. Er und seine Kollegen fordern einen Preis von 3,00 bis 3,50 Euro je Kilo. Philipp Oberdörffer, Fachreferent Küstenfischerei bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, erklärt, dass pro Kilogramm Krabben durchschnittlich drei Liter Kraftstoff benötigt werden. Bei Dieselpreisen zwischen 65 und 73 Cent pro Liter bleibe kein Geld mehr für Schiffsbesatzung, Versicherung, Steuern und das Leben der Familie. An der unbefristeten Aktion beteiligen sich vier Erzeugergemeinschaften, und zwar aus Schleswig-Holstein, die EG Weser-Ems sowie eine Organisation aus den Niederlanden. In Deutschland seien rund 90 Prozent der Fischer in Erzeugergemeinschaften organisiert, in den Niederlanden soll der Organisationsgrad geringer sein.17.10.2008
SlowFisch: Verkostungen können jetzt gebucht werden
Workshops, in denen Messebesucher unter Anleitung von Experten die Geschichte und besondere Eigenheiten der Speisen kennenlernen, haben auf allen Slow Food-Messen Tradition. Auch auf der Slow Fisch, die von Freitag, 7., bis Sonntag, 9. November 2008 in der Messe Bremen stattfindet, kann verkostet und verglichen werden. Ab sofort ist die Anmeldung für folgende Geschmackserlebnisse möglich:16.10.2008