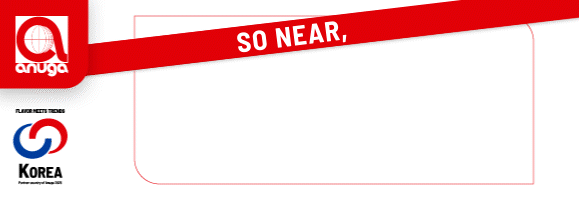01.12.2008
Oldenburg: ‚Spiekerooger Tied’
In Oldenburg öffnet das Restaurant ‚Spiekerooger Tied’ am 6. Dezember mit einem völlig neuen Konzept, meldet die Nordwest-Zeitung. Das schmale Jugendstilhaus in der Achternstraße bietet den Gästen künftig eine große Fischauswahl frisch vom Grill. Die Gäste suchen sich ihren Fisch vorher aus einer Glasvitrine aus: Loup de Mer, Seezunge, Kabeljau, Nordseemakrelen, Steinbutt, Rotzunge, Meeräsche oder Scampis. „Das wird wie so ein Fischmarkt, mit einer offenen Auslage, frisch auf den Grill oder auch zum Mitnehmen“, erklärt Jens Czerlitzka, der das Restaurant führt.01.12.2008
Niederlande: Plattfischverarbeiter Baarssen „in ernsten Schwierigkeiten“
Baarssen Fish International, größter Plattfischverarbeiter in Holland, steckt offensichtlich in ernsten finanziellen Schwierigkeiten, nachdem die Banken dem Unternehmen Kredite verweigert hatten, schreibt die norwegische Zeitung IntraFish. Und das Reformatorisch Dagblad teilt mit, dass Baarssen schon am 27. November einen Teil der Belegschaft „nach Hause“ geschickt und am folgenden Tag keinen Fisch auf der Auktion gekauft habe. „Wir suchen Unterstützung bei den Banken, aber es wird nicht leicht sein“, erklärte Tilly Sintnicolaas, die für Baarssen die Bereiche Kommunikation und Nachhaltigkeit verantwortet. Sollten die Kreditinstitute keine Hilfe leisten, wären eine drastische Reorganisation und Konsolidierung nötig. Sintnicolaas: „Das könnte bedeuten, dass wir mit dem gesunden Teil des Unternehmens einen Neubeginn versuchen.“ Obgleich die gegenwärtige globale Finanzkrise Baarssens Lage verschlechtert habe, begannen die Probleme vor drei Jahren. Baarssen leide noch heute unter Verlusten des Jahres 2005. Eine Ursache sei der Wettbewerb preiswerter Produktalternativen wie Pangasius. Außenstände britischer Kunden, auf deren Zahlungen der in Urk ansässige Familienbetrieb seit mehr als vier Monaten warte, verschlechterten die finanzielle Situation zusätzlich. Schon im März hatte der Verarbeiter zwei Unternehmensabteilungen an die konkurrierende Kennemervis-Gruppe veräußert. Baarssen gehört mit zuletzt 130 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von 65 Mio. € (2007) zu den führenden Fischwirtschaftsbetrieben in Europa.01.12.2008
Russland: MSC-Label für Pollack in „drei bis vier Jahren“
Russlands Alaska-Pollack-Verarbeiter rechnen damit, dass ihre Fischerei in drei bis vier Jahren eine Zertifizierung nach den Kriterien des Marine Stewardship-Councils erfolgreich bestehen könnte, schreibt die norwegische Zeitung IntraFish. „Wir gehen davon aus, dass dann viele Kunden, die den russischen Markt verlassen hatten, weil man von ihnen strikt nachhaltig gefangene Ware verlangte, nach Abschluss der Zertifizierung wieder zurückkehren werden“, erklärte Petr Savchuck, Präsident des führenden russischen Pollack-Produzenten BAMR-ROLIZ. Denn bei führenden LEH- oder Imbiss-Ketten beispielsweise in den USA, wie Wal-Mart oder McDonald’s, sei ein Öko-Label für Lieferanten verpflichtend. Savchuck verspreche sich von dem Label auch bessere Preise für die Filets. Die BAMR-ROLIZ-Gruppe ist ein Zusammenschluss von sieben Fangunternehmen aus dem fernen Osten Russlands, die jährlich 125.000 Tonnen Pollack fangen. Die Gruppe unterhält 21 Fangschiffe und beschäftigt 4.000 Mitarbeiter.28.11.2008
MSC: Zertifizierung für kanadischen Kohlenfisch gestartet
Ende November ist die Fischerei auf Kohlenfisch (Anoplopoma fimbria), auch bekannt als Sablefish oder Black Cod, in die Hauptphase einer Zertifizierung nach den Kriterien des MSC eingetreten. Antragsteller ist die Wild Canadian Sabelfish Ltd., die sämtliche kanadischen Lizenzhalter für die kommerzielle Fischerei der Spezies repräsentiert. Rund 83% des Produktes werden nach Japan exportiert, weitere 12% in die USA, nach Europa und China und die verbleibenden 5% werden im heimischen Kanada veredelt, das heißt geräuchert sowie filetiert oder gesteaked verkauft. Zwei Fangarten werden zertifiziert: mit koreanischen Fallen an der Langleine und mit Langleinenhaken. Auf zwei andere Fischereien des Kohlenfischs – eine kommunale Fischerei der First Nations, der Ureinwohner Kanadas sowie eine Grundfischerei – erstreckt sich das Zertifizierungsverfahren gegenwärtig nicht. Die Gesamtquote für den kanadischen Sablefish lag in der Fangsaison 2007/2008 bei 3.300 t. Die von dem unabhängigen Zertifizierer Moody Marine durchgeführte Prüfung soll in zwölf Monaten abgeschlossen sein.28.11.2008
Pazifischer Heilbutt: Kürzung der Quote um 11,8 Prozent empfohlen
Die Internationale Kommission für die Bewirtschaftung des Pazifischen Heilbutts (IPHC) hat am Dienstag eine Kürzung der Fangquote für das kommende Jahr von 11,8% empfohlen, schreibt die norwegische Zeitung IntraFish. Die IPHC schlägt für 2009 für die Gewässer vor Alaska und vor der Küste von British Columbia eine Quote von insgesamt 54,01 Mio. lbs. (118.965 t) vor, während die TAC für 2008 noch bei 60,4 Mio. lbs. (133.040 t) gelegen hatte. Auf die beiden Fangregionen bezogen, würde das eine Reduzierung vor Alaska um 5% von 43,97 Mio. lbs. (96.850 t) auf 41,72 Mio. lbs. (91.894 t) bedeuten. Für British Columbia sehen die Empfehlungen eine Senkung um 33% vor, und zwar nur noch 12,29 Mio. lbs. (27.070 t) gegenüber 16,43 Mio. lbs. (36.189 t) in der Saison 2008. Vertreter der IPHC werden auf ihrem Jahrestreffen vom 13. bis 16. Januar 2009 im kanadischen Vancouver über die Quotenfestlegung entscheiden.28.11.2008
Aufgeschnappt: „Der Fisch des Führers“
Eine ‚Kochshow der besonderen’ Art erwähnt die Berliner ‚Tageszeitung’ in einem Artikel ihrer heutigen Ausgabe, der ‚die Hitler-Neuigkeiten aus den vergangenen vier Wochen’ vorstellt. Der belgische Fernsehkoch Jeroen Meus wollte in seiner Koch-Show ‚Plat préféré’ des flämischen Fernsehsenders VRT am 28. Oktober die Lieblingsgerichte verschiedener Prominenter zubereiten, schreibt Autorin Svenja Berg. Freddy Mercurys sollte dabei sein, ebenso wie das von Salvador Dalí, Maria Callas – und die Lieblingsspeise von Adolf Hitler. Doch die Forelle in Buttersauce wurde nach Protesten der jüdischen Gemeinde in Belgien nicht vor laufenden Kameras zubereitet – geschehen sollte dies übrigens in Hitlers Residenz „Adlernest“ in Berchtesgaden. Dort wollte der 30jährige Koch laut einer Ankündigung des Senders das „Gericht eines grauenvollen Mannes“ kochen. Die Zeitschrift De Standaard fragte zynisch, wann nun das Lieblingsessen des Kinderschänders Marc Dutroux auf den Tisch käme.28.11.2008
Russland: „Bis 2012 drei Viertel des Fischs aus heimischer Produktion“
Russland will den Anteil heimischer Fischerzeugnisse am Inlandskonsum in den kommenden fünf Jahren von derzeit rund 67,6% auf dann 75,8% erhöhen, schreibt die norwegische Zeitung IntraFish. Die russische Regierung prognostiziert, dass die eigenen Fänge bis 2012 um 23% steigen werden. Im kommenden Jahr solle ein Fünf-Jahres-Plan veröffentlicht werden, der darlegen soll, wie die Effizienz der heimischen Fischwirtschaft gesteigert und die Potentiale der Fischerei entwickelt werden können. So solle die Zahl der Besatzfische in russischen Binnengewässern um 9% gesteigert und die Fisch-Umschlagsmenge in den Seehäfen um 70% erhöht werden. Hierfür müssen einerseits Einrichtungen für die Reproduktion der Fische ausgebaut, die Forschungs- und Entwicklungszentren für Aquakultur und Marikultur entwickelt, außerdem Fischverarbeitungsbetriebe modernisiert und die Infrastruktur der Häfen ausgebaut werden.28.11.2008
Fulda: Sushi-Bar ‚Little Tokyo’
Im osthessischen Fulda hat im November die Sushi-Bar ‚Little Tokyo’ eröffnet – nach Angaben des Fulda-Infos das einzige Sushi-Restaurant im Umkreis von rund 100 Kilometern. Das Restaurant am Gemüsemarkt 12 ist das zweite der Inhaberin Van Doan. Gemeinsam mit ihrem Ehemann betreibt die 30jährige gebürtige Vietnamesin schon eine Sushi-Bar in Kassel. In den großzügigen, im modernen japanischen Stil eingerichteten Räumlichkeiten wird es neben Sushi auch die japanische Grill-Spezialität Teppanyaki und leichte Wok-Gerichte geben. Ein Take-Away-Service, der 10% Rabatt auf die Kartenpreise gewährt, Catering und Sushi-Kurse werden ebenfalls angeboten.28.11.2008
Neuseeland: Preise für Hoki und Muscheln unter Druck
Während es um die Fangmengen und die Bestandssituation beim neuseeländischen Hoki derzeit gut bestellt ist, leiden die Preise für den Fisch unter der internationalen Finanzkrise, schreibt die neuseeländische Tageszeitung The Dominion Post. Ursachen seien die Schwäche des Australischen Dollars – Australien ist Hauptmarkt für Seafood aus Neuseeland – sowie mangelnde Nachfrage der ebenfalls wichtigen Exportländer Japan und USA. Auch der Muschelpreis sei unter Druck. „Wir verkaufen Muscheln für 2,33 €/kg, aber gerade hat ein Kunde angerufen: ‚Wenn Du mir irgendetwas im Januar schicken willst, dann nur für 2,16 € oder lass’ es bleiben’ “, zitierte ein Industrievertreter eine repräsentative Stimme.28.11.2008