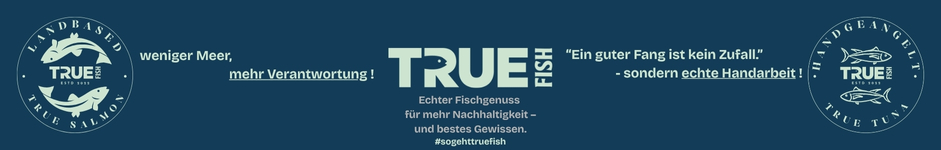22.08.2014
Veränderungen in der Geschäftsführung von Deutsche See
Mit Wirkung zum 15. August ist Hartwig Retzlaff (50) von der Gesellschafterversammlung in die Geschäftsführung von Deutsche See bestellt worden. Er wird die Bereiche Einkauf und Verkauf verantworten. Dr. Peter Dill (55) wird Generalbevollmächtigter des Unternehmens und gibt im Zuge dessen operative Teile seiner bisherigen Verantwortungsbereiche ab und die Geschäftsführerposition auf. In der Position des Generalbevollmächtigten wird er sich wie bisher um das Qualitätsmanagement sowie die Verbandsaufgaben als Vorsitzender des Bundesverbandes der Fischindustrie kümmern. Egbert Miebach (56) bleibt unverändert in seiner Geschäftsführerposition. Der Gesellschafterkreis bleibt ebenfalls unverändert.22.08.2014
Russland will Umgehungen des Importverbots verhindern
Fischproduzenten in den vom russischen Einfuhrverbot betroffenen westlichen Ländern denken über alternative Logistikwege nach, um die Sanktionen zu umgehen. Eine Option sei der Reexport ihrer Produkte über Länder, die nicht dem Handelsverbot unterliegen, schreibt Fish Information & Services (FIS). In Reaktion habe der Leiter der Russischen Föderalen Fischereibehörde Rosrybolovstvo, Ilya Shestakov, "skrupellose Importeure" gewarnt, dass kompetente russische Behörden wie die Veterinärkontrolle Rosselkhoznador und der Föderale Zolldienst (FCS) die Ursprungsnachweise der Produkte kontrollieren würden. Fisch darf beispielsweise weiterhin von den Färöern, aus der Türkei und aus Tunesien nach Russland eingeführt werden. "Die Färöer Inseln können Frischlachs exportieren, allerdings nicht in der Menge, in der wir ihn aus Norwegen importiert hatten", sagte Shestakov im Fernsehsender Rossiya 24. Die Türkei und Tunesien könnten weitere Fischarten frisch liefern. Während einige führende norwegische Lachszüchter wie Salmar und Norway Royal Salmon jetzt den Wegfall eines Exportanteils von bis zu zehn Prozent (Salmar) spüren, könnten Marine Harvest und Cermaq Russland weiterhin aus ihren chilenischen Farmen beliefern. Trond Davidsen vom Züchterverband FHL betonte allerdings, wenn Lachs aus Chile oder von den Färöer Inseln nach Russland verkauft werde, dann sei er auch in den genannten Ursprungsländern produziert worden.22.08.2014
Japan: Ketalachs-Fischerei schleicht sich aus MSC-Programm
Im Frühjahr 2012 hatte die Hokkaido Föderation der Fischereigenossenschaften, in Japan bekannt als Hokkaido Gyoren, mit der MSC-Bewertung für ihren mit Kiemennetzen gefangenen Ketalachs begonnen. Jetzt teilte am 17. Juli 2014 der Zertifizierer SCS Global Services mit, die Fischerei habe sich aus dem MSC-Programm zurückgezogen. Gründe für den Abbruch des Verfahrens wurden nicht genannt. Der MSC hatte den dortigen Ketalachs-Bestand in Hokkaido vor zweieinhalb Jahren als gesund bezeichnet. Im Jahre 2010 waren dort 123.000 Tonnen Lachs angelandet worden, davon 58.400 Tonnen von Hokkaido Gyoren. Damit ist es die zweite Lachsfischerei innerhalb von vier Monaten, die aus dem MSC-Programm ausscheidet: im Mai 2014 hatte schon die russische Fischerei auf den Buckellachs in der zur Insel Sachalin gehörenden Aniva-Bucht die Bewertung ohne Zertifikat beendet. Drei Jahre lang in Folge hatten Russlands Behörden die Fischerei aufgrund zu geringer Rückkehrerzahlen schließen müssen, teilte das Programm 'Sustainable Fishery Partnership' (SFP) mit.22.08.2014
USA: Erstes ASC-Produkt im Lebensmittelhandel
Im Mai diesen Jahres ist erstmals auch in den USA ein Fischprodukt mit ASC-Label in den Lebensmitteleinzelhandel gekommen, teilt der Aquaculture Stewardship Council (ASC) mit. Das alteingesessene Familienunternehmen Tai Foong USA, gegründet 1958, verkauft unter seiner Marke 'Northern Chef' ASC-zertifizierte Tilapiafilets landesweit in verschiedenen Supermarktketten. Damit zählen die USA, einer der weltweit führenden Märkte für Fisch und Seafood, jetzt auch zu den inzwischen 24 Ländern mit ASC-Produkten im Lebensmitteleinzelhandel - 21 Monate, nachdem die ersten ASC-zertifizierten LEH-Produkte in Europa vorgestellt worden waren.21.08.2014
Namibia: Pacific Andes will auf den südafrikanischen Markt
Der chinesische Seafood-Konzern Pacific Andes (Hongkong) engagiert sich mit Gründung des Joint-Ventures Atlantic Pacific Fishing (APF) in Namibia erstmals in Afrika, schreibt IntraFish. Nach Kauf des Trawlers "FV Leader" hält die Neugründung eine Stöcker-Quote von 33.000 t - fast ein Drittel der namibischen Quote von 350.000 t. 92 Prozent der Fänge werden in Namibia und Südafrika gefroren verkauft, die übrigen 8 Prozent zu Fischmehl verarbeitet. Außerdem arbeite Pacific Andes an einer Pilotfarm für Seegurken, die in Asien gefragt sind. An APF ist die Pacific Andes-Tochter China Fishery zu 49 Prozent beteiligt, habe operativ jedoch faktisch die Fäden in der Hand, sagt Geschäftsführer Adolf Burger.21.08.2014
Norwegen: Sämtliche Fischfutter-Hersteller verzichten auf GM-Zutaten
Alle vier großen norwegischen Fischfutter-Produzenten besitzen seit dem Jahre 2008 die Erlaubnis, in ihrem Futter auch gentechnisch veränderte Inhaltsstoffe einzusetzen - machen jedoch von diesem Recht keinen Gebrauch. Auf diesen Umstand wies jüngst Norwegens älteste Tageszeitung Adresseavisen hin. Routinemäßig hätten Skretting, Ewos, Biomar und Polarfeed vor sechs Jahren bei der Norwegischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (NFSA) eine Ausnahmegenehmigung für den Einsatz von GMOs in ihrem Futter beantragt und würden diese jährlich verlängern lassen. Damit dürften die Hersteller 19 verschiedene GM-Pflanzen einsetzen, darunter Mais, Soja und Rapssaat. Alle besitzen eine Sicherheitsbewertung und Zulassung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA). "In Europa nehmen die Märkte bezüglich gentechnisch veränderter Produkte im Fischfutter eine ablehnende Haltung ein - deshalb will die Industrie sie nicht verwenden", begründete Henrik Stenwig, Leiter Gesundheit und Qualität bei der Norwegischen Seafood-Föderation (FHL), den Verzicht, ergänzte aber: "Allmählich wird es jedoch immer schwieriger, Inhaltsstoffe zu erhalten, die nicht gentechnisch verändert sind. In den Hauptanbauländer etwa in Nord- und Südamerika wird es zunehmend unüblich, "Non-GMO-Produkte" anzubauen."21.08.2014
Russland: Kein Lachs mehr bei IKEA
Das schwedische Möbelhaus IKEA wird in seinen russischen Häusern keinen Lachs und keinen Käse mehr verkaufen, berichtet die Nachrichtenagentur ITAR-TASS. Der gefrorene und geräucherte Norweger-Lachs werde ausgelistet, sobald die Lagerbestände aufgebraucht sind, teilte IKEA-Sprecherin Maria Tikhonova mit und erklärte: "Es macht keinen Sinn, den norwegischen Lachs zu ersetzen, denn er ist in Russland eine bekannte skandinavische Marke." Dem Handelsembargo unterliegen hingegen nicht die berühmten schwedischen Fleischbällchen mit Sauce ("Köttbullar"), da sie unter Verwendung von schwedischer Technologie aus russischen oder brasilianischen Zutaten hergestellt würden, sagte Tikhonova.21.08.2014
Russland will angeblich Handelssanktionen lockern
In Russland gibt es offenbar erste Vorschläge, die am 6. August verkündeten Handelssanktionen gegen die EU-Staaten und weitere westliche Länder wieder zu lockern, schreibt Fish Information & Services (FIS). So berichtet die Barentsnova, dass neben laktosefreier Milch, Nahrungsergänzungsmitteln, Samen und Diabetes-Mitteln auch Smolts von der Liste der betroffenen Waren gestrichen werden sollen. Anlass sind offenbar Mitteilungen zweier führender Fischzuchtunternehmen - Russan Sea-Aquaculture und Russian Salmon - an die Regierung, dass der russische Verbraucher ab 2016 keine heimischen Zuchtlachse mehr kaufen könne, sollten die Farmen keine Smolts aus Norwegen mehr importieren dürfen. Zwar arbeitete Russian Sea-Aquaculture an eigenen Brutanstalten, doch werde deren Bau frühestens in zwei Jahren abgeschlossen sein, sagte Geschäftsführer Dmitry Dangauer. Leonov Konstantin, Vertreter der Fischerei-Union, teilte mit, Importe von Smolts des Atlantischen Lachses für Farmen in der Region Murmansk seien an der Grenze gestoppt worden. Das Problem: da Smolts unter Transportbedingungen nur begrenzt lebensfähig seien, habe man nur 72 Stunden für Zollformalitäten und die Logistik vom Schiff zur Farm. Derzeit produziere Russland zehn Prozent des im Lande konsumierten Frischlachses, doch in vier bis fünf Jahren solle der Anteil der Selbstversorgung auf rund ein Drittel oder 70.000 t steigen.20.08.2014
Senegal: Neue Surimi-Fabrik mit 110.000 Tonnen Kapazität
Im westafrikanischen Senegal soll Ende diesen Jahres eine neue Fabrik für Surimi aus "grauen Fischarten" ihren Betrieb aufnehmen, schreibt das Portal IntraFish. Einrichter ist der russische Fischverarbeiter Karelian Industrial Complex (alias Russian Surimi Complex) mit Hauptsitz in St. Petersburg, der im karelischen Sortavala insbesondere Surimi-Sticks, Fischhack und Fischburger produziert. Investor des Projektes, dessen Kosten auf 35 Mio. Euro geschätzt werden, ist der japanisch-europäische Investmentfonds Hermes-Sojitz Direct Investments. Auf einer Fläche von drei Hektar sollen täglich rund 500 Tonnen Fertigprodukte hergestellt werden, jährlich bis zu 110.000 Tonnen Surimi, sagt Fonds-Sprecher Oleg Yantovsky. Ziel sei es, den globalen Surimi-Markt "aufzumischen", der noch Akteure vertrage, meint Yantovsky. Wettbewerbsvorteile solle die neue Produktion aus "innovativer Technik" ziehen, aber auch aus der Verwendung von preiswerteren "grauen" Fischarten wie der Sardinelle, die sich dennoch durch hohen Fettgehalt und entsprechenden Nährwert auszeichneten. Damit reagiere man auf schwindende biologische Ressourcen, Wanderungsbewegungen der Fischarten und reduzierte Fangquoten.20.08.2014
Vietnam: Erstmals kleinere Pangasius-Züchter nach Global-GAP zertifiziert
In Vietnam ist die erste Gruppe kleinerer Pangasius-Farmer nach dem Global-GAP-Standard zertifiziert worden, teilt Global-GAP mit. Die Produzenten-Gruppe Tra Vinh Cooperative in der gleichnamigen Provinz Tra Vinh nimmt am so genannten Public Private Partnership - Sustainable Pangasius Supply Chain Program (PPP-SPSP) teil. Diese "Öffentlich-privaten Partnerschaften" unterstützen die Züchter insbesondere finanziell bei den Zertifizierungen. Anlässlich eines Global-GAP-Workshops auf der Vietfish-Messe am 6. August wies der stellvertretende Vorsitzende der Kooperative, Truong The Van, darauf hin, dass die kleinen Züchter damit einer Regierungsforderung entsprechen, die eine Nachhaltigkeitszertifizierung für sämtliche Pangasius-Farmen bis zum 31. Dezember 2015 verlange. Dr. Kristian Moeller, Global-GAP-Geschäftsführer, begrüßte es, dass die Kleinerzeuger im Aquakultur-Sektor damit dem Beispiel von rund 100.000 Obst- und Gemüsebauern weltweit folgten, die sich bereits für Zertifizierungen in Gruppen zusammengeschlossen haben. Moeller hob hervor, dass die Mehrzahl der deutschen Lebensmittelketten Einkaufspolitiken eingeführt habe, die eine Global-GAP-Aquakulturzertifizierung als Mindestanforderung bei der Lebensmittelsicherheit vorsehen.- Royal Greenland
- Grönland
- Eismeershrimps
- Kaassassuk
- Nuuk
- Preben Sunke
- Johan Berthelsen
- Kaltwassergarnelen
- invasive Art
- Roter Amerikanischer ...
- Flusskrebs
- Krebspest
- Leipzig
- Sachsen
- Procambarus clarkii
- Helgoländer ...
- Hummer
- Helgoland
- illegale Fischerei
- Europäischer ...
- Homarus gammarus
- Heinrich Abelmann
- Bremerhaven
- Listerien
- Rückruf
- Bratheringshappen in ...
- Hering in ...