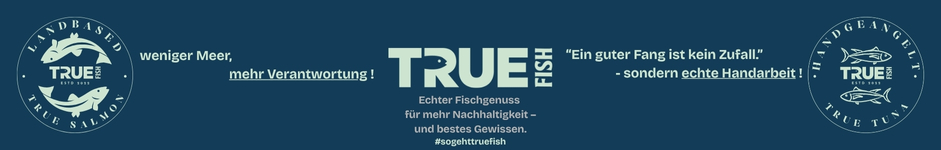18.09.2014
Saudi-Arabien investiert 8,2 Milliarden Euro in die Aquakultur
Das Königreich Saudi-Arabien investiert 8,2 Mrd. Euro in Aquakultur-Projekte, um in den kommenden 16 Jahren eine Million Tonnen Fisch zu produzieren, schreibt IntraFish. Denn der Fischverzehr pro Kopf steigt im Mittleren Osten rapide, insbesondere in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) und im Oman. Während der Konsum dort im Jahre 2010 bei nur 14,4 kg pro Kopf lag, rangierte er 2013 mit 28,6 kg/Kopf unter den höchsten Werten weltweit.18.09.2014
Arabien: Landgestützte Lachszucht startet Anfang 2015
In den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) soll im kommenden Jahr mit der Zucht von Lachs in einer landgestützten Kreislaufanlage begonnen werden, meldet das Portal IntraFish. In der Mehr-Arten-Anlage der neu gegründeten Fish Farm LLC soll zunächst im Januar mit der Zucht von Wolfsbarsch, Dorade und Zackenbarsch gestartet werden - in drei getrennten Becken können insgesamt 300 t produziert werden. In einer zweiten Phase soll ab April in einem separaten Gebäude die Produktion von 200 t Lachs anlaufen, kündigt Betriebsleiter Takis Tountas an. Tountas ist außerdem Prokurist bei Mubarak Fisheries, dem mit einer Produktionsmenge von schätzungsweise 500 t derzeit größten Aquakultur-Unternehmen in den Emiraten. Mubarak Fisheries züchtet in Netzkäfigen vor der Küste von Dibba Wolfsbarsche und Doraden. Jetzt habe man sich ergänzend für die Lachszucht entschieden, da der Fisch in der Region sehr gefragt sei, sagt Tountas: "Wir wollen die höchste Qualität für Hotels züchten, die fünf, sechs und sieben Sterne besitzen." Technikpartner für die Kreislaufanlage ist die dänische Tochter der norwegischen Akva-Gruppe, die im November 2013 von einem Kontrakt mit Fish Farm LLC (Hauptsitz: Dubai) in Höhe von 9,5 Mio. Euro sprach.18.09.2014
Asien: Fangquote für japanische Glasaale um 20 Prozent gesenkt
Japan, China, Taiwan und Südkorea haben beschlossen, die Fanquote für den Japanischen Aal für die im November beginnende Saison um 20 Prozent niedriger anzusetzen als in den zwölf Monaten zuvor, schreibt The Japan Times. Mit der in Tokio getroffenen Vereinbarung reagieren die vier asiatischen Staaten auf die rapide sinkenden Bestände des Anguilla japonicus. Außerdem solle eine stärkere Kooperation beim Aalbestandsmanagement verhindern, dass der Japanische Aal ebenfalls auf der Roten Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens CITES landet. Masanori Miyahara, Berater in Japans Fischereiminsterium, wertet den Beschluss als Beginn eines Prozesses, jedoch nicht als ausreichende Maßnahme.17.09.2014
Frischeparadies startet Onlineshop
Das Frischeparadies steigt ins Onlinegeschäft ein. Ende Oktober will der Feinkost- und Delikatessen-Handel mit einem virtuellen Markt starten, der aus dem umfangreichen Gesamtsortiment von mehr als 12.000 Produkten "die besten 1.200 auswählt", heißt es in einer Pressemitteilung. Bislang können sich Gastroprofis oder Endverbraucher in zehn Frischeparadies-Niederlassungen im deutschsprachigen Raum mit kulinarischen Spezialitäten versorgen. Demnächst kann jeder ambitionierte Hobby-Koch bei Frischeparadies auch dann einkaufen, wenn sich keine Filiale in seiner Nähe befindet. "Wir sind kontinuierlich gewachsen und haben mit unseren Märkten in Deutschland und Österreich ein umfangreiches Netz etabliert. Mit dem Start des Onlineshops decken wir nun die letzten weißen Flecken auf der Landkarte ab", sagt Dietmar Mükusch, Vorsitzender der Geschäftsleitung. Viele Monate sei am Aufbau des Shops getüftelt worden. "Wir haben es geschafft, beste Produkte aus nahezu allen Warengruppen in den Onlineshop zu integrieren", erklärt Vertriebsleiter Christian Horaczek - darunter auch frischer Fisch und Seafood sowie High Pressure Lobster.17.09.2014
China: Erstmals kein Nachwuchs bei Wildstören
Chinas wilde Störbestände haben in diesem Jahr erstmals seit Jahrzehnten offenbar keinen Nachwuchs produziert, meldet die Nachrichtenagentur Agence France Press (AFP). Das erste Mal, seit Forscher vor 32 Jahren mit entsprechenden Aufzeichnungen begannen, fanden sie jetzt keine Störeier in der zentralchinesischen Provinz Hubei und keine Jungstöre, die normalerweise im August den Yangtze hinunter Richtung Meer schwimmen, heißt es in einem Bericht der Chinesischen Akademie für Fischerei-Wissenschaften. Gab es Anfang der 1980er Jahre noch mehrere tausend Störe in China, sind es heute noch etwa 100.17.09.2014
Indien: Steigende Nachfrage lässt Shrimp-Produktion rapide steigen
Indiens Shrimp-Aquakultur ist in den letzten Jahren quasi "exponentiell" gewachsen - eine Entwicklung, die in der Industrie auch mit Skepsis betrachtet wird, schreibt das Portal IntraFish. Von April 2012 bis März 2013 produzierte das Land rund 228.620 t Shrimp, heißt es in Statistiken der Behörde für die Exportförderung von Meeresprodukten (MPEDA). Im entsprechenden Zeitraum 2013/2014 lag die Produktion schon bei 301.435 t - ein Zuwachs von 31,8 %. Der in den USA sitzende Betriebsleiter des indischen Exporteurs Devi Seafoods, Sree Atluri, nannte noch höhere Produktionszahlen: demnach stieg die Erntemenge von 250.000 t (2012/13) auf 353.000 t (2013/14) und soll 2014/15 bei 386.000 t liegen - eine Steigerung von 54,4 % binnen zwei Jahren. Möglich ist die Expansion aufgrund der Kombination mehrerer günstiger Faktoren: die Erträge bei White Shrimp sind gestiegen, neue Gebiete werden für die Garnelenzucht genutzt und gleichzeitig reduzierte die Shrimp-Seuche EMS die Erntemengen vor allem im Hauptproduktionsland Thailand. Hohe Weltmarktpreise motivierten zahlreiche indische Farmer, sich dem "Bonanza" anzuschließen.16.09.2014
Jessen: Störzüchter Aqua Orbis erneut insolvent
Der Störzüchter und Störkaviar-Produzent Aqua Orbis hat Anfang September zum zweiten Mal innerhalb von zwei Jahren Insolvenz angemeldet, schreibt die Mitteldeutsche Zeitung (MZ). Auch in diesem Fall verwaltet der Berliner Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus das Verfahren. Anlass für den neuerlichen Konkurs sei der gescheiterte Verkauf der Störfarm an einen Interessenten aus Kasachstan, heißt es in der MZ. Als Ursache für das Scheitern nennt Rosmarie Ehrenberg, seit März Geschäftsführerin von Aqua Orbis, die von Russland verhängten Sanktionen gegen den Westen: "Kasachstan gehört zu der von Russland bestimmten Eurasischen Wirtschaftsunion." Damit seien die Einfuhr von Kaviar und der Geldtransfer in den Westen gegenwärtig verboten, somit "alle Voraussetzungen für den Kauf unserer Anlage hinfällig geworden." Die Kommanditisten der Störzucht hatten in den zurückliegenden Jahren bereits mehrmals große Summen aufgebracht, um den Betrieb am Laufen zu halten. Ende 2012 kam der Jessener Produzent erneut ins Straucheln, als der deutsch-syrische Investor Yassin Dogmoch sich zurückzog.16.09.2014
Dänemark: Listerien bei Hjerting Laks
In geräuchertem Heilbutt der dänischen Räucherei Hjerting Laks wurden Anfang September Listerien gefunden, schreibt das Portal IntraFish. Dänemark reagiert gegenwärtig besonders sensibel auf die Problematik, nachdem mit Listerien belastete Wurstprodukte in den vergangenen Wochen 15 Todesopfer gefordert hatten. In Reaktion auf den Listerien-Ausbruch hatte die dänische Zeitung Metro Express 46 verschiedene Fischprodukte mehrerer unterschiedlicher Hersteller auf das Bakterium untersuchen lassen, darunter Heilbutt-, Forellen- sowie Lachs-Produkte von der südlich von Esbjerg ansässigen Lachsräucherei. Das Ergebnis des Labors ASL Denmark: zwei Heilbutt-Produkte wiesen eine um den Faktor 68 bzw. 14 erhöhte Listerien-Belastung auf. Hjerting Laks rief daraufhin seine Produkte aus den Supermarktketten Netto, Irma und Føtex zurück und stoppte seine Heilbutt-Produktion. Hjerting-Geschäftsführer Christoph Kjærgaard äußerte sich "ziemlich überrascht". Die Bakterien seien "wahrscheinlich mit dem Rohmaterial 'reingekommen und haben dann eine Maschine kontaminiert". Auch die Dänische Veterinär- und Lebensmittelbehörde zog Proben bei der Räucherei. Hjerting Laks produziert gegenwärtig auf Hochtouren Räucherlachs. Räucherheilbutt mache nur etwa fünf Prozent der Produktionsmenge aus.16.09.2014
USA: "Alaska-Pollack" soll nur noch "Pollack" heißen
Alaska-Pollack muss nicht aus den Gewässern des US-Bundesstaates Alaska stammen, sondern kann auch in Russland gefischt worden sein. Das soll sich ändern, fordert die US-amerikanische Vereinigung der Alaska-Pollack-Produzenten (GAPP), zu der unter anderem Trident Seafoods, American Seafoods und Unisea gehören, schreibt das Portal IntraFish. In einer Petition an die US-Lebensmittelbehörde (FDA) bemängeln die US-Hersteller, dass das "minderwertige russische Produkt" von der Marke Alaska profitiere und argumentieren: "Wir haben starke Belege dafür, dass der gegenwärtig am Markt zugelassene Name, der die geographische Beschreibung 'Alaska' enthält, den Verbraucher täuscht und irreführend ist."16.09.2014